Die zunehmende Vernetzung von Haushaltsgeräten und Gesundheits-Apps ermöglicht es vielen Nutzern, persönliche Daten effizienter zu erfassen und auszuwerten. Eine beliebte Waage, die Renpho WiFi Smart Scale, bietet neben präziser Gewichtsmessung auch die Möglichkeit, Gesundheitsdaten per App einzusehen. Doch für viele Anwender ist es wünschenswert, diese Daten nicht nur in der Hersteller-App zu sehen, sondern auch in anderen smarten Systemen wie Home Assistant zu integrieren. Die Herausforderung liegt hierbei vor allem in der Art und Weise, wie die Renpho-App mit ihren Servern kommuniziert und wie die verschlüsselten Datenpakete analysiert werden können, um sie für die heimische Automatisierung nutzbar zu machen.Die Hintergründe für das Reverse Engineering der Renpho-App sind ebenso praktisch wie persönlich: Viele Menschen nutzen Home Assistant, um ihr Smart Home zu steuern.
Die Visualisierung auf einem zentralen Dashboard vereinfacht den Alltag und eröffnet neue Möglichkeiten, zum Beispiel automatische Erinnerungen an die Gewichtsmessung zu versenden. Gerade in Zeiten von Homeoffice oder eingeschränktem Bewegungsradius spielen solche Erinnerungen eine wichtige Rolle beim Erhalt der Gesundheit.Der wesentliche Schritt bei der Integration der Renpho-Waage in ein individuelles System besteht darin, die API-Aufrufe, Endpunkte und Datenformate, die von der App verwendet werden, zu identifizieren. Dies umfasst die Anmeldung im System, das Abrufen der aktuellen Gewichtswerte sowie weiterer Nutzerdaten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Kommunikation meist über verschlüsselte Verbindungen (SSL/TLS) erfolgt, was ein einfaches Mitschneiden des Datenverkehrs erheblich erschwert.
Die erste naheliegende Methode, um an diese Daten zu gelangen, ist der Versuch des Paket-Sniffings mit Tools wie Wireshark. Leider ist die reine Erfassung am heimischen Rechner oft problematisch. Das liegt unter anderem an den restriktiven Eigenschaften moderner WLAN-Chipsätze, die das Abhören des eigenen WiFi-Datenverkehrs erschweren. Zudem schützt die SSL-Verschlüsselung die Datenübertragung, so dass die erfassten Pakete nur verschlüsselte Informationen enthalten.Wer sich mit Reverse Engineering befasst, steht daher vor zwei Hauptoptionen.
Die eine besteht darin, den Datenverkehr gezielt abzufangen und zu entschlüsseln, die andere im Analysieren und Decompilieren der ursprünglichen App, um herauszufinden, wie die Daten vor dem Versand aufbereitet werden. Gerade für Nutzer ohne umfassende Programmierkenntnisse ist die zweite Methode durch den hohen Komplexitätsgrad häufig eine große Hürde.Eine erfolgreiche Herangehensweise zur Traffic-Analyse bei der Renpho-App besteht darin, eine Android Virtual Device (AVD)-Umgebung aufzusetzen. Durch die Verwendung einer Android-Version unter 7 wird es möglich, vom Nutzer installierte Zertifikate für die SSL-Entschlüsselung zu vertrauen. So lassen sich dann Werkzeuge wie PCAPDroid kombinieren, um den Netzwerkverkehr der App zu filtern und über eine Proxy-Lösung wie mitmproxy zu leiten.
Der Vorteil liegt darin, dass man auf diese Weise den verschlüsselten Verkehr in Klartext schreiben kann, ohne ein physisches Gerät rooten zu müssen.Der Aufbau dieser Testumgebung erfordert einige technische Grundkenntnisse: Zunächst wird ein virtuelles Android-System mit Android Studio eingerichtet und die Renpho-App installiert. Anschließend kopiert man das erforderliche Proxy-Zertifikat auf das virtuelle Gerät und installiert es. PCAPDroid übernimmt dann das Monitoring des Netzwerkverkehrs und filtert gezielt die Datenströme der Renpho-App heraus. Darüber hinaus wird der Verkehr über einen SOCKS5-Proxy zu mitmproxy weitergeleitet, wodurch die SSL-Verschlüsselung durchbrochen wird und die tatsächlichen Daten sichtbar gemacht werden.
Nach erfolgreichem Einrichten und Anmelden in der App lassen sich in den Logs interessante JSON-Datenpakete erkennen, die die Antwort des Servers enthalten. Besonders auffällig ist hier der terminal_user_session_key, ein Token, das für weitere Anfragen notwendig ist und eine Session repräsentiert. Er scheint zeitlich begrenzt und wird bei jeder erneuten Anmeldung aktualisiert. Dieses Verhalten entspricht gängigen Standards bei sicheren API-Authentifizierungen und bietet einen Anknüpfungspunkt zur Nachbildung von API-Requests in eigenen Anwendungen.Eine der zentralen Herausforderungen ist die Art und Weise, wie das Passwort für die Anmeldung verarbeitet wird.
Die App übermittelt nicht einfach einen Klartext, sondern eine verschlüsselte oder zumindest nach einem festen Verfahren transformierte Passwortdarstellung. Auffällig ist, dass sich der sogenannte Password-Hash bei jeder Anmeldung ändert, obwohl das Klarpasswort identisch bleibt. Dieses Verhalten deutet auf einen Salt-Mechanismus oder eine Kombination aus dynamischen Eingabewerten hin, die eine einfache Wiedergabe über bekannte Hash-Algorithmen verhindert.Das Identifizieren der genauen Verschlüsselungsmethode lässt sich durch weitere Analyse der App oder mittels Decompiling ergründen. Es ist anzunehmen, dass dazu eine Kombination von Eingangsparametern wie E-Mail-Adresse, Passwort und möglicherweise ein Zeitstempel oder eine Version der App verwendet wird.
Die Tatsache, dass die Verschlüsselung dynamisch ist und sich bei jeder Anfrage unterscheidet, macht eine einfache Nachbildung deutlich schwieriger. Dennoch bleibt das Ziel, mittels Reverse Engineering ein funktionierendes Anmeldeverfahren nachzubauen, um eigene Anwendungen zu entwickeln, die Daten der Waage abrufen können.Ein Vorteil der Methode, den Datenverkehr direkt zu entschlüsseln, besteht darin, dass man so ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zumindest die grundlegenden API-Endpunkte und Datenformate erfassen kann. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich bei der Renpho-Backend-Architektur offenbar um eine REST-API handelt, die JSON für die Datenübertragung nutzt und über HTTPS angesprochen wird. Neben Login und Authentifikationsmechanismen existieren auch Endpunkte, über die aktuelle Gewichtsdaten und historische Messwerte abgerufen werden können.
Diese Informationen ermöglichen die Entwicklung von eigenen Dashboards oder die Integration in bestehende Smart Home Systeme.Insgesamt zeigt der Reverse Engineering Prozess der Renpho-App, wie durch technische Versiertheit und Nutzung frei verfügbarer Tools komplexe Systeme analysiert werden können. Die Community profitiert dabei von zahlreichen Open Source Anwendungen wie mitmproxy, Android Studio und PCAPDroid, die solche Eingriffe erst möglich machen.Für Anwender, die selbst gewillt sind, persönliche Gesundheitsdaten nicht nur in proprietären Apps zu verwalten, sondern diese auch im Zusammenspiel mit eigenen Automatisierungsprojekten zu integrieren, lohnt sich dieser Aufwand ganz besonders. So entsteht ein individueller Nutzen, etwa in Form von personalisierten Erinnerungen, Langzeitstatistiken und der zentralen Einbindung in das digitale Zuhause.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass solch ein Projekt auch datenschutzrechtliche Überlegungen mit sich bringt. Das Verständnis, wie die eigenen Werte übertragen und gespeichert werden, ist essenziell für einen bewussten Umgang mit Gesundheitsdaten. Gleichzeitig verdeutlicht die Möglichkeit, durch Reverse Engineering die Technik hinter solchen Apps zu verstehen, dass Nutzer zunehmend Kontrolle über ihre Daten gewinnen können.Die Zukunft der Smart Health-Lösungen wird von interaktiven und nutzerzentrierten Systemen geprägt sein, die nahtlos mit der haustechnischen Infrastruktur kommunizieren. Der Weg von der Nutzung einzelner Apps hin zur ganzheitlichen Integration von Fitness- und Gesundheitsdaten bietet viele Chancen – Renpho und ähnliche Anbieter können durch offene Schnittstellen und transparente Kommunikation davon gleichermaßen profitieren.
Bis dahin sind technische Lösungen wie das Reverse Engineering wichtige Zwischenschritte, um den digitalen Fortschritt individuell mitzugestalten und eigene digitale Ökosysteme optimal zu nutzen.






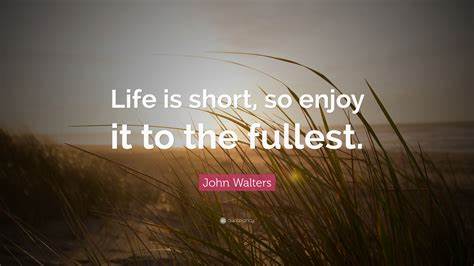

![HUD and DOI Open Under Utilized Federal Lands for Affordable Housing [video]](/images/3A603086-AFAF-4C62-A23C-4E270891D696)
