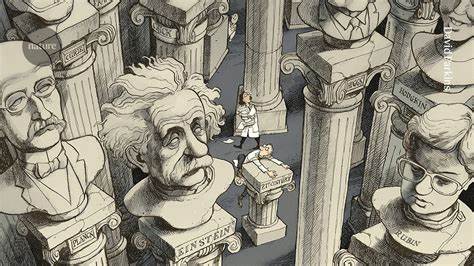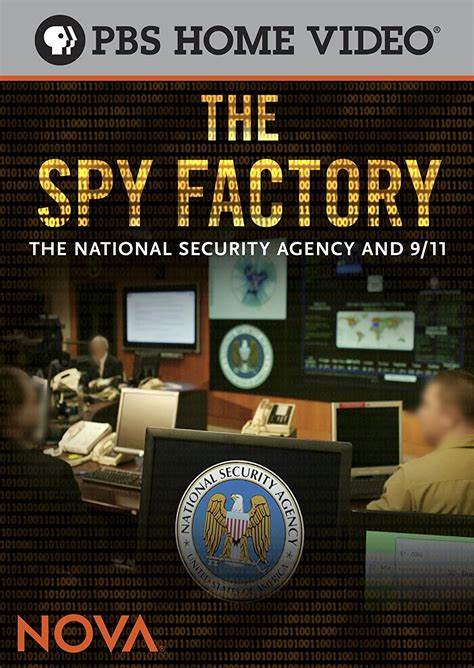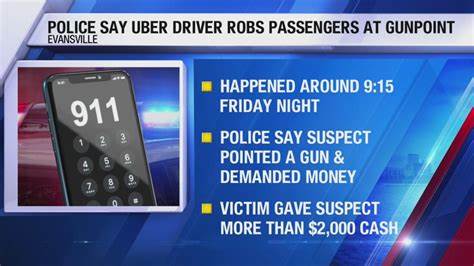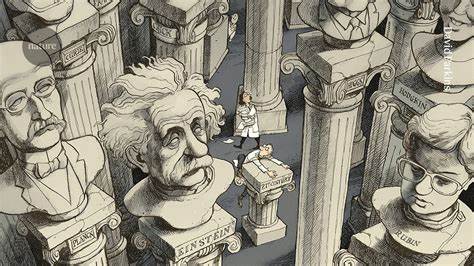Wissenschaftliche Durchbrüche gelten seit jeher als Motor des Fortschritts. Ob die Entdeckung der DNA-Struktur, die Entwicklung von Antibiotika oder die Erfindung des Internets – bahnbrechende Innovationen haben unser Leben verändert und wirtschaftliches Wachstum maßgeblich vorangetrieben. Doch nun mehren sich die Stimmen, die behaupten, dass solche fundamentalen Entdeckungen immer schwerer zu finden sind. Die Debatte über eine mögliche Innovationskrise in der Wissenschaft gewinnt an Bedeutung und ist sowohl unter Forschern als auch in politischen Kreisen umstritten. Doch warum könnte es tatsächlich schwieriger sein, heute noch revolutionäre Durchbrüche zu erzielen? Und wie lässt sich das überhaupt messen? Einflussreiche Forscher wie Russell Funk und sein Team haben in Studien gezeigt, dass wissenschaftliche Arbeiten im Durchschnitt immer weniger disruptiv sind, das heißt, sie ersetzen oder verändern bestehende Paradigmen seltener.
Anstatt frühere Arbeiten obsolet zu machen, bauen viele neue Publikationen lediglich auf bestehenden Kenntnissen auf und konsolidieren diese. Dieses Phänomen wurde mithilfe des sogenannten Konsolidierungs-Disruptions-Index (CD-Index) erfasst, der analysiert, wie Referenzen in Fachartikeln zitiert werden. Ein hoher CD-Index deutet auf disruptive Forschung hin, da nachfolgende Arbeiten eine bahnbrechende Studie zitieren, ohne deren Quellen zu beachten. Allerdings ist diese Methodik nicht unumstritten. Kritiker argumentieren, der CD-Index könne durch veränderte Zitationskulturen und administrative Faktoren verfälscht werden.
Beispielsweise haben heutige Wissenschaftler oftmals eine viel größere Anzahl von Referenzen in ihren Arbeiten, was eine direkte Vergleichbarkeit mit früheren Jahrzehnten erschwere. Neben dem CD-Index wird auch die Analyse von Neuheitsmaßen verwendet, um Innovation zu messen. Dabei wird untersucht, wie stark eine Arbeit unterschiedliche Forschungsdisziplinen vereint und ob sie neuartige Kombinationen von Begriffen präsentiert. Doch auch hier bestehen Herausforderungen: Ein hoher Neuheitswert spricht zwar für innovative Ansätze, sagt aber nicht zwingend etwas über deren disruptiven Einfluss aus. Denn viele neue Kombinationen können inkrementelle Fortschritte darstellen, die bestehendes Wissen erweitern, aber nicht revolutionieren.
Die schwer fassbare Natur von Durchbrüchen zeigt sich auch an prominenten Beispielen. Der Nobelpreis für die Entwicklung von AlphaFold, einer bahnbrechenden KI-basierten Methode zur Vorhersage von Proteinstrukturen, gilt als Meilenstein moderner Wissenschaft. Dennoch erzielt die entsprechende Publikation einen vergleichsweise niedrigen CD-Index. Dies unterstreicht die Schwierigkeit, bahnbrechende Innovationen ausschließlich über Zitationsstatistiken oder Neuheitsmaße zu erfassen, und weist auf die Notwendigkeit neuer Bewertungsmethoden hin. Ein weit verbreiteter Eindruck unter Forschern ist, dass trotz exponentiell wachsender Investitionen in die Wissenschaft die Anzahl wirklich bahnbrechender Entdeckungen nicht proportional zunimmt.
Die ökonomische Produktivität, die stark von Innovation abhängt, stagniert seit Jahrzehnten in wohlhabenden Ländern. Zudem zeigen Untersuchungen aus verschiedenen Forschungsfeldern eine abnehmende Effizienz: So sind heute zum Beispiel achtzehnmal mehr Forscher nötig, um das Mooresche Gesetz im Bereich der Halbleitertechnik aufrechtzuerhalten, als in den 1970ern. Ähnliche Trends gibt es in der Agrarforschung oder bei neuen Behandlungsmethoden für Krankheiten. Die Ursachen für die erschwerte Innovationsfindung sind vielschichtig. Ein oft genanntes Problem ist die wachsende Bürokratie: Forscher verbringen heute einen großen Teil ihrer Zeit mit Antragsstellungen, Verwaltung und Lehre, was die Kapazität für kreative Forschung einschränkt.
Historisch betrachtet hatten bahnbrechende Wissenschaftler wie Watson und Crick deutlich mehr Freiheit, unkonventionelle Pfade zu beschreiten. Heutige akademische Karrieren sind dagegen stark reglementiert und verlangen schnelle Publikationen, was den Mut für riskante, innovative Ideen dämpfen kann. Eine weitere Herausforderung ist die sogenannte „Salamischeibentaktik“, bei der Ideen auf viele kleine Artikel verteilt werden, die jeweils nur inkrementelle Fortschritte enthalten. Dies führt dazu, dass der disruptive Charakter der Forschung verwässert wird und die wahre Innovationskraft schwer erkennbar bleibt. Auch der enorme Kostenaufwand moderner Wissenschaft mit großen Infrastrukturprojekten und hochkomplexen Geräten könnte eine Rolle spielen.
Die Barrieren für den Zugang zu teurer Ausrüstung sind hoch, was insbesondere junge Forscher und kleinere Institutionen benachteiligt. Hinzu kommt, dass das wissenschaftliche Wissen insgesamt so umfangreich geworden ist, dass es deutlich länger dauert, sich zum Experten auf einem Gebiet zu etablieren. Der Satz „Wir stehen auf den Schultern von Riesen“ gewinnt neue Dimension, denn diese „Riesen“ werden immer größer und komplexer, was es für Nachwuchswissenschaftler schwieriger macht, die Innovationsspitzen zu erreichen. Auch die wissenschaftliche Gemeinschaft selbst ist Teil des Problems. Durch soziale Medien und algorithmische Empfehlungssysteme werden Forscher oft auf eine kleine Anzahl populärer Artikel gelenkt.
Dies kann sogenannte Herdeneffekte verstärken, bei denen wichtige, aber komplexe oder ungewöhnliche Arbeiten übersehen werden. Infolgedessen erhalten nur wenige Publikationen die erforderliche Aufmerksamkeit, um als bahnbrechend anerkannt zu werden, während andere wichtige Entdeckungen erst spät oder gar nicht gewürdigt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Forschungsgemeinschaft bestrebt, bessere Methoden zu entwickeln, um disruptive Wissenschaft zu identifizieren und zu fördern. Geplant sind unter anderem Experimente, bei denen Forscher selbst bewerten, welche unveröffentlichten Arbeiten das Potenzial haben, bahnbrechend zu sein, um dies später mit tatsächlichen Zitationen und Anerkennung zu korrelieren. Ebenfalls wird versucht, die Sprache in wissenschaftlichen Texten genauer zu analysieren, um neue Indikatoren für Innovation zu finden.
Politische und gesellschaftliche Implikationen dieser Diskussion sind enorm. Innovationen sind ein zentraler Motor von wirtschaftlichem Wachstum und gesellschaftlicher Entwicklung. Die Tatsache, dass Wissenschaft möglicherweise immer weniger disruptive Fortschritte liefert, alarmiert Regierungsbehörden und Förderinstitutionen weltweit. Einige Vertreter der US-amerikanischen Forschungspolitik fordern mehr Unterstützung für „cutting-edge“-Forschung statt für inkrementelle Verbesserungen, obwohl in manchen Fällen die Fördermittel gerade gekürzt werden. Die komplexen Ursachen für eine mögliche Innovationskrise erfordern komplexe Antworten.
Es wird zunehmend erkannt, dass einfache Erhöhung der Forschungsausgaben und Anzahl der Forscher nicht automatisch zu mehr Durchbrüchen führt. Vielmehr müssen kreative Freiräume, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Unterstützung riskanter Projekte und verbesserte Bewertungsmethoden gefördert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, wie sie in der Vergangenheit viele einschneidende Veränderungen bewirkt haben, heute tatsächlich schwerer zu finden sein könnten. Die Ursachen liegen in strukturellen Veränderungen der Forschungskultur, methodischen Herausforderungen bei der Bewertung von Innovationen und wachsenden wissenschaftlichen Barrieren. Die Debatte ist dabei keineswegs abgeschlossen und bleibt ein zentrales Thema für Wissenschaftler, Förderer und Politik.
Nur durch ein tieferes Verständnis und gezielte Förderung kann die Wissenschaft wieder zu dem Motor bahnbrechender Veränderungen werden, der Gesellschaft und Wirtschaft in eine erfolgreiche Zukunft führt.