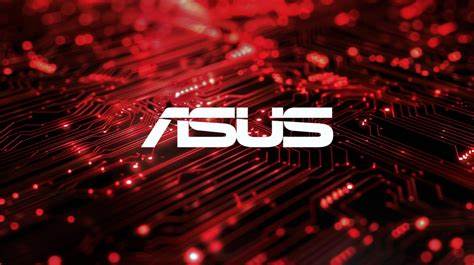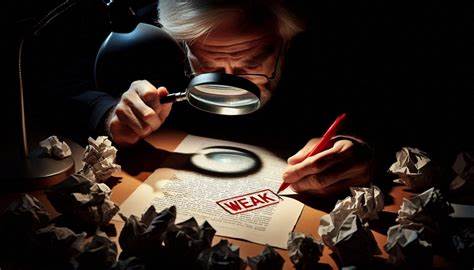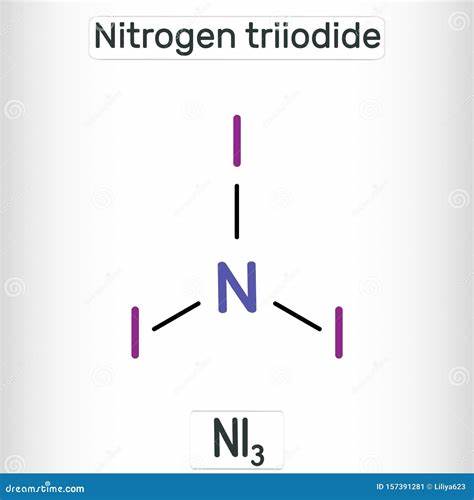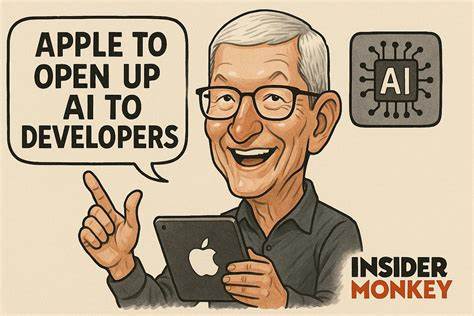In den letzten Jahren hat die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und insbesondere generativer KI für große Begeisterung gesorgt. Industrieexperten, Medien und viele Tech-Firmen prophezeien eine Revolution der Produktivität, die unser Leben grundlegend verändern wird. Sie versprechen, dass Maschinen bald fast alle Tätigkeiten übernehmen können, die derzeit von Menschen ausgeführt werden, und so eine Ära grenzenlosen Wohlstands einläuten. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die vor einem unreflektierten Glauben an diese Technologie warnen. Einer der bekanntesten Experten auf diesem Gebiet ist der Volkswirtschaftler Daron Acemoglu, der 2024 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde.
In seinen jüngsten Analysen entwirft er ein nüchternes Bild der tatsächlichen Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft und Gesellschaft – fernab vom Hype und den unrealistischen Erwartungen vieler Optimisten. Acemoglu betont, dass die Prognosen von Branchenführern und renommierten Beratungsunternehmen wie Goldman Sachs und McKinsey zwar höhere Wachstumsraten durch KI vorhersagen, diese Einschätzungen jedoch aus ökonomischer Sicht nur schwer zu untermauern sind. Während Goldman Sachs beispielsweise einen Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 7 Prozent über das nächste Jahrzehnt erwartet, und McKinsey den jährlichen Wachstumszuwachs um drei bis vier Prozentpunkte beziffert, zeigt eine genaue Analyse der verfügbaren Daten und ökonomischen Modelle eher ein bescheideneres Bild. Im Zentrum von Acemoglus Argumentation steht die sogenannte „Totale Faktorproduktivität“ (TFP), ein Maß für die Effizienz, mit der Inputs wie Arbeit und Kapital in Output umgewandelt werden. Ein wesentlicher Grundsatz der Wirtschaftstheorie, Hultens Theorem, besagt, dass die Produktivitätssteigerung einer Technologie davon abhängt, wie viele Aufgaben durch sie automatisiert werden können, multipliziert mit den durchschnittlichen Kosten- und Zeiteinsparungen.
Analysen zeigen, dass generative KI-Tools bereits heute gewisse Effizienzgewinne in einfachen Tätigkeiten wie dem Schreiben von Internettexten oder der Zusammenfassung von Dokumenten bewirken. Studien von Forschern wie Shakked Noy und Whitney Zhang legen nahe, dass solche Tools durchschnittliche Kosteneinsparungen von etwa 14 bis 27 Prozent im Bereich der Arbeit leisten können. Dennoch ist die Anzahl der tatsächlich durch KI automatisierbaren Aufgaben vergleichsweise gering – Schätzungen von Acemoglu zufolge liegt dieser Anteil bei etwa 4,6 Prozent aller beruflichen Tätigkeiten. Diese beiden Faktoren zusammengenommen lassen nur eine moderate Steigerung der Produktivität durch KI erwarten. Die jährliche Steigerung der TFP durch KI dürfte nach seinen Berechnungen bei lediglich rund 0,06 Prozent liegen, was auf ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von ungefähr ein bis anderthalb Prozent in den kommenden zehn Jahren hinauslaufen könnte.
Das ist ein signifikant bescheidenerer Wert als in vielen Zauberformeln und Schlagzeilen angegeben wird. Ein weiterer wichtiger Punkt in Acemoglus Analyse ist, dass diese Produktivitätsgewinne nicht gleichmäßig über alle Berufsgruppen und Bevölkerungssegmente verteilt sein werden. Während frühere Phasen der Automatisierung vor allem bestimmte Berufsgruppen und sozial schwächere Schichten hart getroffen haben, könnte die Verbreitung von KI zwar besser verteilt sein, allerdings ohne die Ungleichheit zu verringern oder die Löhne spürbar steigen zu lassen. Im Gegenteil, Kapitalbesitzer dürften insgesamt mehr vom KI-Boom profitieren als die Arbeitnehmer. Besonders stark exponiert sind bestimmte Gruppen wie etwa weißhäutige, gebürtige Frauen.
Dies wirft wichtige Fragen zur sozialen Gerechtigkeit und zur Gestaltung von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auf. Acemoglus Skepsis richtet sich auch gegen die gängige Annahme, Künstliche Intelligenz werde „automatisch“ positive Effekte entfalten und als eine Art „allgemeine Technologie“ alle Bereiche der Gesellschaft beflügeln. Er weist darauf hin, dass die Tech-Industrie in der Praxis oft auf Automatisierung und Monetarisierung von Nutzerdaten setzt, anstatt radikal neue Aufgaben und Produktfelder zu schaffen. Seine Kritik umfasst auch die Rolle der Politik und Regulierung: Es sei gefährlich, den Technologiekonzernen das Feld zu überlassen und unreflektiert den Optimismus zu teilen, dass technologische Fortschritte von allein allen nützen werden. Interessanterweise schließt Acemoglu nicht aus, dass KI im Bereich der wissenschaftlichen Forschung für bemerkenswerte Durchbrüche sorgen kann, beispielsweise bei komplexen Problemstellungen wie der Entdeckung neuer Kristallstrukturen oder der Proteinfaltung.
Solche Entwicklungen könnten langfristig wirtschaftlich relevant sein, sind nach seiner Einschätzung aber in den nächsten zehn Jahren kaum ein großer Wachstumsmotor. Der Fokus der Branche liege gegenwärtig auf kurzfristig verwertbaren Automatisierungsanwendungen und weit weniger auf der Innovation im eigentlichen Sinne. Seine realistische Bewertung bleibt auch dann bestehen, wenn man die Optimierungsschwierigkeiten berücksichtigt, die sich bei sogenannten „komplexeren“ Aufgaben ergeben. Tätigkeiten, die stark kontextabhängig sind – etwa die Diagnose von Krankheiten oder die Finanzberatung – setzen klare Erfolgskriterien voraus, die sich nur schwer für KI-Modelle quantifizieren lassen. Hier ist ein Lernen ausschließlich auf Basis bestehender menschlicher Verhaltensmuster schwierig, weshalb die Produktivitätsgewinne begrenzt bleiben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Daron Acemoglu mit seiner Expertise und seinem nüchternen Blick auf Künstliche Intelligenz einen wichtigen Gegenpol zur verbreiteten Euphorie darstellt. Statt sich von übertriebenen Wachstumsprognosen und der Vorstellung einer baldigen Automatisierung nahezu aller menschlichen Tätigkeiten mitreißen zu lassen, mahnt er zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie an. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie produktiv diese sein könnte, sondern auch um die millionenfachen Konsequenzen für Arbeit, Einkommen und gesellschaftliche Gleichheit. Die Rolle der Politik und der Gesellschaft ist dabei zentral. Eine kluge Regulierung, die Innovation fördert, aber gleichzeitig den sozialen Ausgleich wahrt, könnte verhindern, dass KI zu einem weiteren Motor wachsender Ungleichheit wird.
Es geht darum, Technologien so zu gestalten und zu steuern, dass sie der breiten Bevölkerung zugutekommen und nicht nur wenigen Kapitalbesitzern oder Großkonzernen. Für Unternehmen und Arbeitnehmer bedeutet Acemoglus Analyse, dass man die Erwartungen an KI realistisch halten und sich zugleich auf die erforderlichen Veränderungen vorbereiten sollte. Weiterbildung, Umschulung und ein stärkeres Augenmerk auf soziale Schutzmechanismen werden unverzichtbar sein. Für Entscheidungsträger bietet sich die Gelegenheit, nicht nur auf den technologischen Fortschritt zu reagieren, sondern ihn aktiv zu gestalten. Abschließend zeigt die Arbeit des Nobelpreisträgers, dass der Hype um Künstliche Intelligenz mit Vorsicht zu genießen ist.
KI ist zweifelsohne ein mächtiges Werkzeug mit großem Potenzial, aber sie ist kein Wundermittel für grenzenlosen Wohlstand. Stattdessen erfordert die Zukunft der Arbeit und der Wirtschaft einen ausgewogenen und informierten Diskurs, der sowohl Chancen als auch Risiken offenlegt und die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt. Nur so kann KI tatsächlich zu einem Hebel für gesellschaftlichen Fortschritt werden, anstatt bestehende Herausforderungen zu verschärfen.