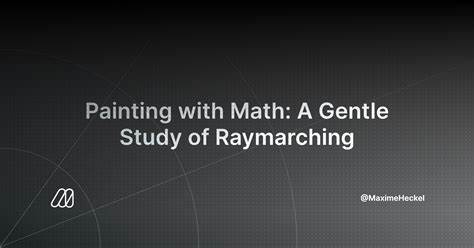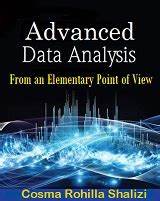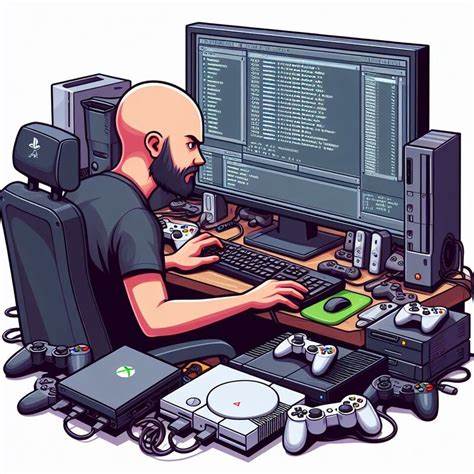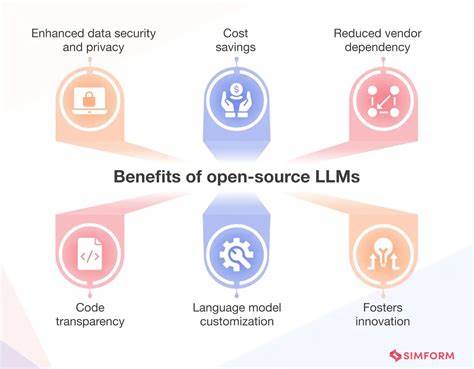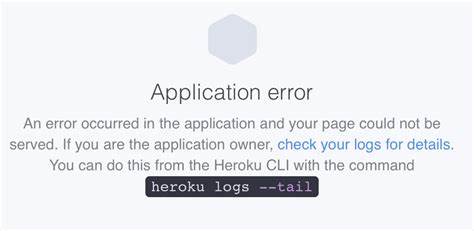In der modernen Computergrafik gewinnen Shader-Techniken zunehmend an Bedeutung. Besonders das Raymarching als alternative Render-Methode eröffnet Künstlern und Entwicklern neue Möglichkeiten, beeindruckende 3D-Welten ausschließlich auf Basis mathematischer Funktionen zu erschaffen – ganz ohne klassische Geometrie oder texturbasierte Materialien. Diese Methode, die mit einfachen, kompakt gehaltenen GLSL-Fragment-Shadern funktioniert, ist mittlerweile populär geworden, insbesondere durch Plattformen wie Shadertoy, in denen Entwickler atemberaubende Landschaften, Wolkenformationen und geometrische Fraktale präsentieren. Doch was steckt wirklich hinter Raymarching, und warum ist es so mächtig für kreatives Arbeiten mit Shadern? Die Antwort liegt im Zusammenspiel von Mathematik, Kreativität und effizientem Rendering. Raymarching unterscheidet sich grundlegend vom gewöhnlichen Rasterisierungsverfahren, das in klassischen Drei-D-Szenen angewendet wird.
Während Rasterisierung die 3D-Geometrie eines Modells in Bildschirmpixel umwandelt, verzichtet Raymarching komplett auf vorab definierte Meshes. Stattdessen werden virtuelle Strahlen (Rays) von einem Beobachtungspunkt aus in eine Richtung gesendet. Diese Strahlen durchwandern den Raum schrittweise (daher „marching rays“), bis sie auf eine Oberfläche treffen oder eine maximale Distanz beziehungsweise Schrittanzahl überschreiten. Das eigentliche Herzstück dieser Technik ist die Nutzung sogenannter Signed Distance Fields (SDFs), mathematischer Funktionen, die für jeden Punkt im Raum die kürzeste Distanz zur Oberfläche eines Objekts angeben. Der größte Vorteil von SDFs ist ihre universelle Anwendung: Ob Kugel, Box, Torus oder sogar komplexere Gebilde – mit passenden mathematischen Formeln lassen sich die Umrisse nahezu beliebiger Formen definieren und kombinieren.
Das macht es möglich, ganze Szenen aus einfachen Bausteinen zusammenzusetzen, die sich nahtlos miteinander verschmelzen oder schneiden lassen. Diese Flexibilität eröffnet unzählige kreative Möglichkeiten. Darüber hinaus ermöglichen sogenannte Smoothmin-Funktionen das Verschmelzen von Objekten ohne störende Kanten, was besonders organic wirkende Übergänge erzeugt. Ein grundlegendes Verständnis der Raymarching-Technik ist ohne Kenntnisse im GLSL und 3D-Mathematik kaum möglich. Deshalb raten Profis, sich zuerst mit Konzepten wie Vektoren, Matrizen und dem Aufbau von Shadern vertraut zu machen.
Mit Blick auf die Implementierung einer einfachen Raymarcher-Szene nutzen viele Entwickler zunächst eine vollflächige Ebene als Leinwand, auf die der Shader angewendet wird. So kann das aufwändige Zeichnen der Geometrie entfällt, und der Fokus liegt komplett auf den mathematischen Funktionen im Shader-Code. Das Raymarching beginnt typischerweise mit der Definition des Ursprungs der Strahlen – also der Kamera- oder Beobachterposition – und der Richtung, in die der Strahl ausgesendet wird. Normalerweise wird die Richtung durch die Normalisierung eines Vektors definiert, der aus den UV-Koordinaten des Pixels im Bildraum und einem zusätzlichen Achsenwert (zum Beispiel entlang der negativen Z-Achse) besteht. Anschließend überprüft eine Schleife wiederholt den Abstand des aktuell erreichten Punktes zur nächste(n) Oberfläche(n).
Wird der Abstand kleiner als ein definierter Schwellenwert (Surface Distance), wird angenommen, dass die Oberfläche getroffen wurde. Durch diese iterative Methode wird ein pixelgenaues Bild berechnet, das oft überraschen realistische und komplexe Strukturen erzeugt. Die Rechenintensität der Methode ist jedoch ein Faktor, der bedacht werden muss: Die maximale Anzahl der Schritte und die Genauigkeit der Distanzmessung beeinflussen stark die Performance. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, mit einem Device Pixel Ratio von 1 oder niedriger zu arbeiten, um die Framerate auf mobilen Geräten oder leistungsschwächeren Computern zu optimieren. Neben der bloßen Form der Objekte spielt Licht eine wesentliche Rolle für die visuelle Qualität der Szene.
Im Gegensatz zu klassischem Rasterizing verfügt das Raymarching nicht automatisch über Normalvektoren auf Oberflächen, welche essenziell für Lichtberechnungen sind. Eine beliebte Methode, das Oberflächennormal zu approximieren, ist die Nutzung von finite Differenzen, die durch Abfragen der Distanzfunktion in unmittelbarer Nachbarschaft des Treffpunkts ermittelt werden können. Dabei entstehen Vektoren, die die Ausrichtung der Oberfläche approximieren. Auf Basis dieser Normalen kann mit einfachen Diffusumberechnungen durch den Dot-Product zwischen Lichtvektor und Normalvektor der Einfluss der Beleuchtung simuliert werden. Das Ergebnis sind lebendige Schattenwürfe und eine spürbare Plastizität der Formen.
Wer es noch realistischer möchte, kann mit der Implementierung von Soft Shadows experimentieren. Diese Technik berechnet weiche Schatten, indem sie entlang eines Lichtstrahls die Entfernung zu Hindernissen abtastet und die Lichtintensität entsprechend moduliert. Dieses Verfahren ist besonders bei komplexen Szenen oder wenn mehrere Lichtquellen aufeinander treffen, optisch eindrucksvoll. Durch geschicktes Kombinieren und Transformieren von SDFs lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand bemerkenswerte Kompositionen erstellen. Das Verschmelzen von Objekten ist mit mathematischen Min- und Max-Funktionen realisierbar, wobei das Min-Operator für die Vereinigung zweier Formen steht und Max deren Schnittmenge beschreibt.
Die Positionierung der Objekte erfordert ein Umdenken, denn nicht das Objekt wird im Raum verschoben, sondern im Shader der Abfragepunkt des SDF um die inverse Verschiebung transformiert. Gleiches gilt für Rotation und Skalierung, die ebenfalls mithilfe von Transformationsmatrizen im Shader auf den Abfragepunkt angewandt werden, um so komplexe Bewegungen und Anordnungen zu ermöglichen. Skalierung beeinflusst dabei nicht nur die räumliche Größe, sondern auch die Schrittweite des Raymarchers; daher muss der resultierende Abstand entsprechend angepasst werden, um die Kollision präzise zu erkennen. Rotation wiederum erfordert eine gute Beherrschung von Rotationsmatrizen und deren Anwendung im dreidimensionalen Raum, die mathematisch oft herausfordernd sind, aber essenziell für realistische und flexible Animationen und Szenen sind. Einer der beeindruckendsten Aspekte von Raymarching ist die Möglichkeit, scheinbar unendliche Welten zu generieren.
Durch sogenannte Repeat-Funktionen, die den Modulo-Operator auf den Abfragepunkt anwenden, lassen sich ganze Szenerien periodisch und nahtlos kacheln. Das führt zu faszinierenden Effekten, bei denen Objekte in alle Richtungen wiederholt auftauchen, als ob sich der Raum unendlich erstreckt. Diese Technik schafft etwa endlose Landschaften oder komplexe architektonische Strukturen. Noch weiter getrieben wird die Wiederholungstechnik in der Erstellung von Fraktalen. Ein beliebtes Beispiel ist der Menger-Schwamm, der mittels iterativer Kombination von SDFs für Quader und Kreuzformen entsteht.
Durch schrittweises Verkleinern und Verschachteln der Strukturen entsteht ein Detailreichtum, der theoretisch ins Unendliche wachsen kann. Dabei sind die zuvor erläuterten Smoothmin-Funktionen von großer Bedeutung, um unschöne Kanten und Übergänge zu vermeiden. Zur Realisierung naturnaher Landschaften bieten sich verschiedene Rauschmethoden an, wobei Fraktale Brownsche Bewegung (Fractal Brownian Motion) eine zentrale Rolle spielt. Diese Technik kombiniert mehrfach übereinander gelagerte, skalen- und amplitudenveränderte Noise-Funktionen, um natürliche Strukturen mit scharfen Details und zufälliger Variation zu erzeugen. Der Aufbau erfolgt meist iterativ, wobei pro Iteration Frequenz und Amplitude verändert werden, teilweise auch um Rotationen ergänzt, um die Variation zu erhöhen.
Eine weitere Verfeinerung entsteht durch die Anwendung von Noise-Derivaten. Diese Methode nutzt nicht nur die Werte der Noise-Funktion, sondern untersucht zusätzlich deren Steigung, was zu einem tieferen Verständnis der Geländeform führt. So entstehen realistischere Höhenprofile mit ausgeprägten Tälern und markanten Berghängen. Um diese Technik umzusetzen, werden Noise-Werte und deren Ableitungen über Samples einer Noise-Textur berechnet und in die Terrain-Formel eingespeist. Landschaften wirken durch Licht, Schatten und atmosphärische Effekte erst wirklich lebendig.
Nebel, der je nach Entfernung und Höhe variiert und die Sicht einschränkt, verbessert den räumlichen Eindruck enorm. Ein gängiger Ansatz beruht auf dem physikalischen Beer'schen Gesetz, das die Lichtabsorption in Medien beschreibt. Die Implementierung arbeitet mit exponentiellem Zerfall in Abhängigkeit von der Distanz und der Dichte der Atmosphäre, was zu weich verlaufenden Nebelzonen führt. Die Kombination aus Raymarching, komplexen Noise-Funktionen, dynamischem Licht und atmosphärischen Effekten lässt sich nutzen, um nicht nur realistische, sondern auch künstlerisch interpretierte Welten zu bauen. Die Dateigröße des Quellcodes bleibt dabei oft gering, da die Szenen mathematisch beschrieben sind, was gegenüber aufwendigen Polygonmodellen mit Texturen und umfangreichen Geometrien klare Vorteile bietet.
Die kreative Freiheit, die Raymarching durch die direkte Steuerung der mathematischen Distanzfelder bietet, ist für viele Entwickler und Shader-Künstler ein großer Reiz. Von abstrakten Formen, die flüssig ineinander übergehen, über komplexe Fraktale bis hin zu detaillierten Landschaften mit dynamischem Licht und Wetter – eine ganze Welt neuer Gestaltungsmöglichkeiten tut sich auf. Zudem eröffnet das Verfahren interessante Perspektiven für VR- und Echtzeitanwendungen, wo die hohe Flexibilität bei der Szenengestaltung zu immersiven und einzigartigen Erlebnissen führen kann. Ein weiterer zukunftsträchtiger Bereich, der eng mit Raymarching verwandt ist, umfasst volumetrische Effekte wie Rauch oder Nebel. Diese nutzen ähnliche Prinzipien, gehen aber noch einen Schritt weiter, indem sie Dichtevolumen durchstrahlen und dynamische Lichtstreuung simulieren.