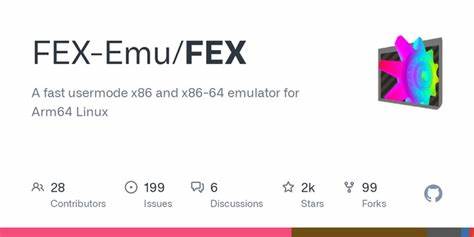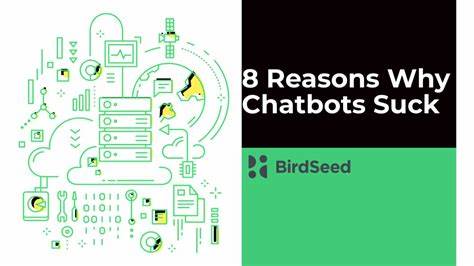Michel Barnier, bekannt als der ehemalige Chefunterhändler der Europäischen Union für den Brexit und kurzzeitiger Premierminister Frankreichs, hat harte Worte gegenüber der aktuellen Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gefunden. In seinem kürzlich erschienenen Buch beschreibt Barnier eine „autoritäre Drift“ unter von der Leyens Führung und wirft der Kommissionspräsidentin vor, zunehmend zentralistisch und wenig dialogorientiert zu agieren. Die Kritik bietet einen tiefen Einblick in interne Machtmechanismen und Spannungen im Herzen der Europäischen Union. Die Wahrnehmung eines autoritären Trends unter Ursula von der Leyen resultiert laut Barnier vor allem aus einer zunehmenden Dominanz der Kommission, die seiner Meinung nach eher als technokratisches Gremium denn als demokratisch legitimiertes Politikerkollegium agiert. Barnier konstatiert, dass die Kommissare sich immer mehr zu „Super-Technokraten“ entwickeln und oft den Bezug zur Bevölkerung vermissen lassen.
Seiner Ansicht nach herrscht eine mangelnde Bereitschaft, auf die Bedürfnisse und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger einzugehen, was die demokratische Legitimation der Institution schwächen könnte. Die Kritikpunkte von Barnier sind dabei nicht nur persönlicher Natur, sondern betreffen auch konkrete politische Herausforderungen und Entscheidungen während von der Leyens Amtszeit. So bemängelt er die langsamen Fortschritte bei der Integration der Kapitalmärkte in Europa, ein Schlüsselthema für wirtschaftliche Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt. Auch sieht er die Regulierungsflut als überzogen an, die häufig wirtschaftliche Innovationen behindere oder verkompliziere. Diese Aspekte machen die Tiefe der inneren wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen innerhalb der EU deutlich, die oft im Schatten der medialen Aufmerksamkeit verlaufen.
Besondere Brisanz entfaltet Barniers Kritik im Kontext der Brexit-Verhandlungen, für die er als Chefunterhändler eine zentrale Rolle spielte. Barnier wirft von der Leyen vor, ihn in den letzten Verhandlungsphasen mit dem damaligen britischen Premierminister Boris Johnson bewusst auszubremsen und auszuschließen. Laut Barnier habe er erwartet, gerade in den entscheidenden Stunden der Verhandlungen an der Seite der Kommissionspräsidentin zu sein, was jedoch nicht der Fall war. Dieses Vorgehen wertet Barnier als politisch intolerant und zeigt die Spannungen innerhalb der Spitzenebenen der EU-Institutionen auf. Ein besonders sensibles Thema innerhalb der Brexit-Verhandlungen war für Barnier die Fischereipolitik, die seiner Ansicht nach von von der Leyen zugunsten eines schnellen Handelsabkommens mit Großbritannien nunmehr relativiert wurde.
Er bezeichnet die Fischerei als „sekundär, möglicherweise sogar marginal“ gewordenes Verhandlungsthema unter ihrer Führung. Um den Interessen der französischen Fischereiwirtschaft Nachdruck zu verleihen, sah er sich gezwungen, Präsident Emmanuel Macron einzubeziehen, der mit einem Vetodrohung gegen das Abkommen intervenierte. Diese Episode unterstreicht, wie nationalstaatliche Interessen in den oft komplexen EU-Verhandlungen eine bedeutende Rolle spielen und durch interne Machtspiele beeinflusst werden können. Trotz seiner Kritik erkennt Barnier klar an, dass Ursula von der Leyen mit der Bewältigung großer Krisen, wie der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, gute Arbeit geleistet habe. Ihre Fähigkeit, diese Herausforderungen anzugehen, hebt Barnier als positive Seiten ihrer Amtsführung hervor und zeigt, dass seine Kritik differenziert betrachtet werden muss.
Es geht ihm nicht um eine generelle Ablehnung von von der Leyen, sondern um eine konstruktive Auseinandersetzung mit der politischen Ausrichtung und den Arbeitsmethoden der Europäischen Kommission. Darüber hinaus zeichnet Barnier in seinem Buch auch ein Bild von den internen Verhältnissen und der politischen Kultur hinter den Kulissen der EU. Er prangert den Mangel an Wertschätzung persönlicher Beziehungen und zwischenmenschlicher Arbeitsweisen an, die ihm in der Zusammenarbeit mit von der Leyen fehlten. Das Thema der menschlichen Dimension in der Politik, das oft hinter der bürokratischen Fassade verborgen bleibt, wird hier wieder sichtbar und weist auf potenzielle Schwachstellen im Funktionieren der EU-Exekutive hin. Barniers Stellungnahmen haben im EU-Lager für Diskussionsstoff gesorgt.
Während die Europäische Kommission sich zu den Aussagen bislang nicht näher geäußert hat, eröffnen sie eine wichtige Debatte über die Demokratie, Transparenz und Effizienz in den europäischen Institutionen. Insbesondere die künftige strategische Ausrichtung der EU und die Rolle der Kommission im Zusammenspiel mit den Mitgliedstaaten stehen dabei zur Debatte. Im Hinblick auf Barniers eigene politische Karriere ist das Buch zudem ein Versuch, sich wieder stärker in der französischen Innenpolitik zu positionieren. Seine kurze Amtszeit als Premierminister, die als die kürzeste der modernen französischen Geschichte in Erinnerung bleibt, scheint ihm dabei keine Barriere zu sein. Im Gegenteil, mit seinem Buch und den darin geäußerten Positionen könnte Barnier zumindest Aufmerksamkeit und Unterstützung für mögliche kommende politische Herausforderungen gewinnen.
Ein zentrales Thema, das Barnier und von der Leyen trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten verbindet, ist die gemeinsame Zugehörigkeit zur konservativen Europapartei, der Europäischen Volkspartei (EVP). Dennoch zeigt sich, dass parteipolitische Zusammengehörigkeit keineswegs gleichbedeutend mit inhaltlicher oder persönlicher Einigkeit sein muss. Die Spannungen innerhalb der EVP und zwischen wichtigen Führungspersönlichkeiten spiegeln die komplexen politischen Realitäten innerhalb der EU wider. Die Kritik Barniers an der „autoritären Drift“ wirft essentielle Fragen für die Zukunft der Europäischen Union auf. Wie kann die EU effektiver und gleichzeitig demokratischer werden? Wie lässt sich die Balance zwischen technokratischer Expertise und politischer Legitimation halten? Und wie können die Interessen der Bürgerinnen und Bürger besser eingebunden werden, um die Handlungsfähigkeit und Akzeptanz der Union in einer sich wandelnden Welt zu sichern? Die Rolle der Europäischen Kommission als Exekutive des Bündnisses steht dabei besonders im Fokus.
Nach Barniers Einschätzung wird unter von der Leyen zu sehr zentralisiert und wenig partizipativ agiert, was den Ruf nach einer Reform lauter werden lässt. Dabei geht es nicht nur um interne Machtstrukturen, sondern auch um die Außenwirkung der EU und deren Fähigkeit, politische Herausforderungen wie Globalisierung, geopolitische Spannungen und gesellschaftliche Wandel zu bewältigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Michel Barniers harsche Kritik an Ursula von der Leyens Führung innerhalb der Europäischen Kommission ein Schlaglicht auf bestehende Herausforderungen und Spannungen in Brüssel wirft. Seine persönliche Perspektive als erfahrener Politiker und Verhandler eröffnet einen fundierten Blick hinter die Kulissen der EU und fordert mehr Transparenz, Dialog und Demokratie im Handeln der europäischen Institutionen. Während der aktuelle Kommissionspräsidentin zugebilligt wird, bedeutende Krisen bewältigt zu haben, mahnt Barnier eine Kurskorrektur an, um den europäischen Integrationsprozess nachhaltig zu stärken und das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen.
Diese Debatte wird in den kommenden Jahren entscheidend sein für den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Europäischen Union.