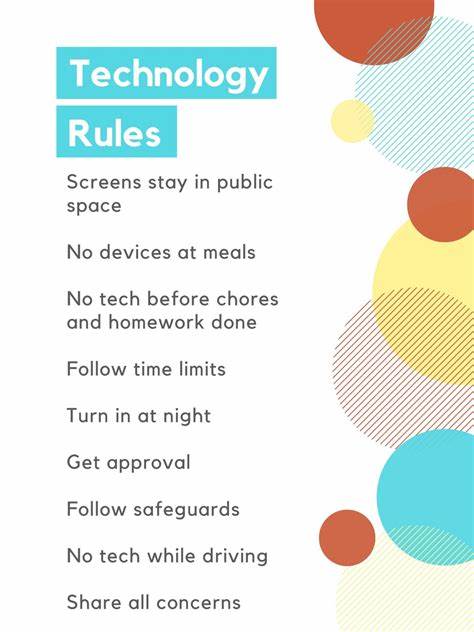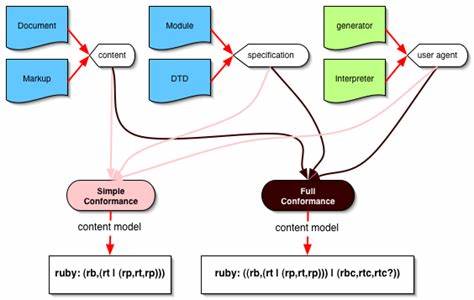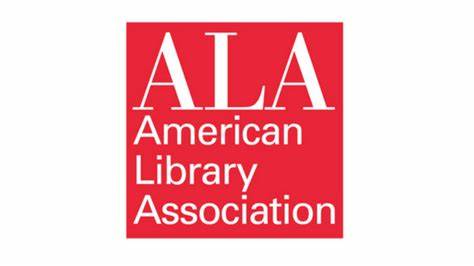Die rasante Entwicklung neuer Technologien prägt unseren Alltag wie kaum eine andere Kraft in der Geschichte. Von Smartphones über künstliche Intelligenz bis hin zu großen Datenzentren – wir sind ständig von neuen Geräten und Systemen umgeben, die unser Leben beeinflussen. Doch trotz aller Fortschritte stellt sich die Frage, ob moderne Technik tatsächlich das leistet, was man sich einst von ihr versprach. Wendell Berry, ein amerikanischer Schriftsteller und Umweltschützer, formulierte bereits 1987 neun grundlegende Anforderungen für neue Technologien, die auch heute, Jahrzehnte später, nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben. Seine Liste ist ein Maßstab, an dem sich messen lässt, wie verantwortungsvoll oder fahrlässig heutige technologische Innovationen gestaltet sind.
Berry, der damals noch auf einem Bauernhof in Kentucky lebte und seine Texte mit Stift und Papier verfasste, wurde von Freunden ermutigt, einen Computer zu nutzen. Doch er stellte die entscheidende Frage: Warum sollte man neue Technologie überhaupt annehmen? Daraus entstanden seine neun klaren Kriterien, die nicht nur sinnvoll, sondern heute sogar dringlicher erscheinen als jemals zuvor. Das erste Kriterium besagt, dass eine neue Technologie günstiger sein sollte als das, was sie ersetzt. Früher war das tatsächlich der Fall. Fernseher wurden erschwinglicher, Computer günstiger und leistungsfähiger.
Doch seit einigen Jahren erlebt man eine Trendumkehr, die besonders anhand der Preisentwicklung von Smartphones, speziell iPhones, sichtbar wird. Die Geräte werden teurer, obwohl die Innovationen oft marginal erscheinen. Es scheint, als ob die Kosten vieler Technologien nicht mehr mit der gebotenen Leistung übereinstimmen. Das zweite Prinzip fordert, dass neue Geräte nicht größer oder sperriger sein sollten als ihre Vorgänger. Jahrzehntelang hat die Technik sich darauf konzentriert, kleiner, leichter und portabler zu sein – ein Trend, den insbesondere Steve Jobs mit seinen Produkten maßgeblich vorangetrieben hat.
Smartphones haben zahlreiche Geräte ersetzt und sind zum multifunktionalen Schweizer Taschenmesser geworden. Allerdings hat sich auch hier eine Verschiebung abgezeichnet: Während das iPhone 6 noch das dünnste Gerät seiner Zeit war, haben spätere Modelle wieder an Größe und Gewicht zugenommen. Darüber hinaus sind die riesigen Rechenzentren für KI und Cloud-Computing gigantische Bauten, die immense Mengen an Platz und Energie benötigen. Dieses Wachstum steht im Gegensatz zu Berrys Forderung nach kompakteren Lösungen. Weitaus entscheidender ist das dritte Kriterium, dass neue Technologien einen klaren und nachvollziehbaren Fortschritt in der Funktionalität bieten müssen.
Doch hier zeigen sich gravierende Probleme. Viele moderne Software-Plattformen und Anwendungen erscheinen für Nutzer zunehmend komplizierter und weniger intuitiv. Bekannte Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder E-Commerce-Seiten wurden über die Jahre nicht immer besser, sondern oft verschlechtert, teilweise aus wirtschaftlichen oder werblichen Interessen. Die Nutzererfahrung nimmt ab, was viele zu Frust führt. Das vierte Prinzip dreht sich um den Energieverbrauch.
Neue Technologien sollten sparsam im Umgang mit Energie sein und möglichst effizient funktionieren. Doch gerade mit dem Aufstieg von datenintensiven Anwendungen, etwa im Bereich der künstlichen Intelligenz, ist der Energiebedarf extrem gestiegen. Große Rechenzentren verbrauchen ungeheure Mengen Strom, was zunehmend kritisch für die Umwelt ist und den Klimawandel beschleunigt. Dies steht im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsgedanken, den Berry bereits 1987 einforderte. Ein weiterer, fast visionärer Punkt Berrys ist die Forderung, dass technologische Geräte idealerweise eine Form von Solarenergie oder körpereigener Energie nutzen sollten.
Diese Idee wirft einen Blick auf nachhaltige, alternative Energien, die die Umwelt weniger belasten. Während private Haushalte vermehrt Solarenergie einsetzen, bleibt die Entwicklung in der Tech-Industrie in Bezug auf regenerative Energiequellen eher zögerlich, was zeigt, dass dieser Gedanke noch lange nicht vollständig umgesetzt wurde. Besonders bedeutsam ist auch der Wunsch, dass neue Technik leicht reparierbar sein sollte – und zwar von Menschen mit normaler Intelligenz, sofern sie die entsprechenden Werkzeuge besitzen. Dies ist zum Teil heute nicht mehr gegeben. Ein fester Trend zu sogenannten "Black-Box"-Geräten macht Reparaturen nahezu unmöglich.
Viele Hersteller bauen nicht nur technische Barrieren ein, sondern auch Software-Verriegelungen, die das eigenständige Instandsetzen verhindern. In einzelnen Fällen wurde dies sogar gesetzlich problematisch, etwa bei landwirtschaftlichen Maschinen oder während der COVID-19-Pandemie bei wichtigen medizinischen Geräten. Das siebte Prinzip lautet, technologische Produkte sollten nahe am Wohnort erhältlich und zu reparieren sein. Während der Online-Handel zwar bequem ist, haben viele Produkte ihre lokale Verfügbarkeit und Servicefähigkeit eingebüßt. Gerade in ländlichen oder abgelegenen Regionen ist die Wartung und Reparatur oft schwierig, da Fachläden geschlossen wurden und Servicezentren immer weiter entfernt sind.
Darüber hinaus wünscht sich Berry, dass neue Technologien vorzugsweise aus kleinen, privaten Werkstätten oder Geschäften stammen, die auch eine Rücknahme und Wartung garantieren. Diese Idee einer nachhaltigen und persönlichen Beziehung zwischen Hersteller und Nutzer ist in der heutigen globalisierten Massenproduktion kaum noch zu finden. Vielmehr dominieren große Konzerne, die durch geplante Obsoleszenz Produkte so gestalten, dass sie möglichst bald ersetzt und nicht repariert werden. Die Lebenszyklen der Geräte sind kurz, und viele Nutzende haben nicht einmal das Eigentum an der Software oder Hardware, sondern lediglich Nutzungsrechte, die jederzeit widerrufen werden können. Abschließend fordert Berry, dass neue Technologien bestehende gute Dinge nicht ersetzen oder zerstören sollten, insbesondere in Bezug auf Familien- und Gemeinschaftsbeziehungen.
Dieser Aspekt ist heute besonders schmerzhaft spürbar, denn viele digitale Plattformen, vor allem soziale Medien, haben negative Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden, zwischenmenschliche Bindungen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Offenbar beabsichtigen manche Konzerne, Abhängigkeiten zu fördern und die Nutzer bei der Stange zu halten, selbst wenn das dem individuellen und sozialen Wohl schadet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wendell Berrys Liste vor über drei Jahrzehnten einen realistischen und verantwortungsvollen Rahmen für technologische Innovationen bot. Sie fordert Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit, Nutzerorientierung und vor allem echten Mehrwert. Viele der heutigen Technologien erfüllen diese Anforderungen nicht oder wenden sich sogar gegen sie.
Die Konsequenzen sind vielfältig: von steigendem Ressourcenverbrauch über den Verlust von Kompetenz im Umgang mit Technologie bis hin zu gesellschaftlichen Problemen. Um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, sind die Prinzipien Berrys aktueller denn je. Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind gefragt, neue technologische Entwicklungen nicht nur nach kurzfristigen Profitkriterien zu beurteilen, sondern nach ihrer langfristigen Tauglichkeit für eine lebenswerte Welt. Viele Menschen sehnen sich daher nach einer Rückbesinnung auf jene Werte, die Technik als Diener und Helfer des Menschen sehen, nicht als Gegenspieler. Die Debatte um den verantwortungsvollen Umgang mit Innovationen gewinnt an Dringlichkeit, denn Technik ist nicht per se gut oder schlecht – es kommt darauf an, wie sie gestaltet und eingesetzt wird.
Wendell Berrys neun Regeln bieten eine Orientierungshilfe, die nicht nur für Entwickler und Unternehmer, sondern für alle, die sich mit dem Wandel auseinandersetzen, unverzichtbar ist. Die Wiederentdeckung und Umsetzung dieser Werte könnte dazu beitragen, eine Zukunft zu schaffen, in der Fortschritt und Menschlichkeit Hand in Hand gehen.