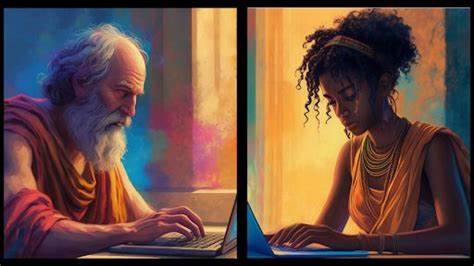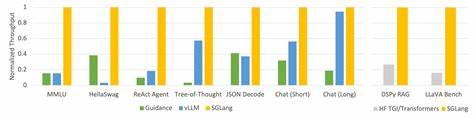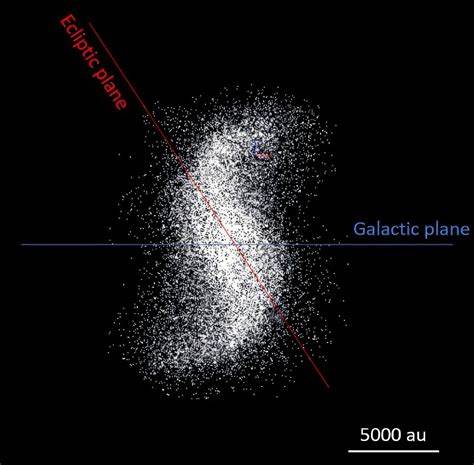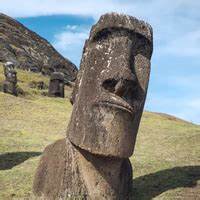Technische Vorstellungsgespräche waren schon immer eine Herausforderung – sowohl für die Bewerber als auch für die Unternehmen. Es geht weit über das reine Abfragen von technischem Wissen hinaus. Erfolgreiche Interviews sollen bewerten, wie Kandidatinnen und Kandidaten denken, wie eigenständig sie Probleme lösen, wie es um ihr Urteilsvermögen steht und ob sie in der Lage sind, in einem dynamischen Umfeld zu agieren. Diese Qualitäten lassen sich nicht einfach mit einem Fragenkatalog messen. Immer wieder müssen Recruiter und technische Interviewer Signale deuten und komplexe Eindrücke zusammensetzen, um ein möglichst vollständiges Bild über den potenziellen neuen Mitarbeiter zu gewinnen.
All das in einem meist knapp bemessenen Zeitrahmen, der von Nervosität auf beiden Seiten geprägt ist. Vor diesem ohnehin komplizierten Setting beginnt nun das Zeitalter der großen Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), die die Spielregeln des technischen Interviewprozesses erheblich verändern. Der wesentliche Unterschied zur Vergangenheit ist, dass diese KI-Tools nicht einfach technische Aufgaben lösen – sie sind in der Lage, genau die Art von Aufgaben zu meistern, die in Interviews gestellt werden. Dies führt zu grundsätzlichen Fragen darüber, wie die Fähigkeiten eines Bewerbers noch zuverlässig gemessen werden können, und das Bewerbungsverfahren vor allem keine verzerrten Ergebnisse hervorbringt. Die Herausforderung in der Praxis: Interviewfragen sind bewusst so ausgelegt, dass sie schnell verständlich sind, innerhalb einer Stunde bearbeitet werden können und ein klar umrissenes Problem ohne zu viel Kontext bieten.
Diese Rahmenbedingungen machen es LLMs besonders leicht, Lösungen zu generieren – oft schneller und fehlerfreier als Menschen. Dadurch entsteht ein Risiko für Unternehmen, Fehleinschätzungen vorzunehmen. Wenn etwa ein Bewerber die Unterstützung durch eine KI wie Copilot oder ChatGPT nutzt, kann es schwer sein zu erkennen, welche Anteile der Lösung authentisch sind und wie gut die Person tatsächlich die Aufgabe versteht oder eigenständig löst. Ein weiteres Problem besteht darin, dass dadurch die sogenannte „Signal-zu-Rauschen“-Relation leidet. Das bedeutet, es wird schwieriger, echte Stärken von einem vielleicht nur gut präsentierten Ergebnis aufgrund des Einsatzes von KI zu trennen.
Ein Vorstellungsgespräch hat somit grundsätzlich mehr Lärm, weniger klare Signale. Vor diesem Hintergrund rücken die Kernziele eines Interviewprozesses noch stärker in den Fokus: Das Minimieren von falsch positiven Ergebnissen – also Situationen, in denen Kandidaten im Interview glänzen, im Job aber scheitern – und gleichzeitig das Vermeiden von falsch negativen Ergebnissen, bei denen Talente übersehen werden. Die Technologie und ihre Implikationen machen es notwendig, das Interviewdesign neu zu überdenken. Dabei zeigt sich, dass der Umgang mit LLMs kein „ob“, sondern ein „wie“ sein sollte. Künftig ist davon auszugehen, dass Programmierarbeit und Problemlösungen intensiver durch KI-Tools unterstützt werden – so, wie die Arbeit heute kaum noch ohne Suchmaschinen oder Code-Dokumentationen stattfindet.
Eine Schlüsselfrage lautet daher, wie das Interview so gestaltet werden kann, dass die Nutzung von LLMs als Partner verstanden wird, dessen Einsatz die Fähigkeiten des Kandidaten ergänzt und nicht ersetzt. Es gilt, zu beobachten, wie die Bewerber die KI-Tools einbinden, wie kritisch sie angebotene Lösungen prüfen und wie sie Entscheidungen reflektieren. Ein interessantes Ungleichgewicht ergibt sich bei verschiedenen Tools. Copilot, das direkt im Code-Editor assistiert und häufig proaktiv Vorschläge unterbreitet, simuliert das echte Arbeitsumfeld gut. Für Personen, die Copilot schon gewohnt sind, kann dies die Produktivität erhöhen und ihnen Raum für höherwertiges Denken eröffnen.
Gleichzeitig erschwert Copilots automatischer Vorschlagsmodus das gezielte Beobachten kritischer Denkprozesse, weil die Tools oft ungefragt Lösungen präsentieren. ChatGPT hingegen funktioniert vielmehr wie eine fortschrittliche Suchmaschine. Der Nutzer muss explizit Fragen stellen und dann bewerten, welche Antworten hilfreich sind. Im Interview erlaubt dieses Verhalten ein transparentes Beobachten der Fragetechnik und das Verständnis über die Fähigkeit, Informationen kritisch auszuwerten und einzusetzen. Interessanterweise birgt auch das vollständige Verbot von KI-Einsatz seine Risiken.
Es entfernt die Interviews weit von der tatsächlichen Arbeitsrealität, in der KI-Werkzeuge immer mehr zum Alltag gehören. Gleichzeitig gibt es im Job Situationen, in denen KI nicht weiterhelfen kann. Daher macht es Sinn, bestimmte Teile des Interviewprozesses bewusst LLM-frei zu halten, um die klassischen technischen und zwischenmenschlichen Kompetenzen auf den Prüfstand zu stellen. Ein Beispiel hierfür sind Whiteboard-Sessions, in denen Projektmanagement, Architekturentwürfe und Kundenkommunikation geübt werden. In solchen Situationen ist KI-Einsatz weniger praktikabel, was auch das reale Arbeitsumfeld widerspiegelt.
Innovative Unternehmen haben begonnen, ihren Interviewprozess dementsprechend aufzuteilen. Zu den Standards gehören oft mehrere Programmieraufgaben, bei denen zumindest die Nutzung von ChatGPT gestattet wird, um zu beobachten, wie Kandidaten mit KI interagieren. Gleichzeitig werden Whiteboard-Interviews für andere Kompetenzbereiche angewandt und explizit als KI-frei kommuniziert. Diese Regeln werden vorab transparent an Bewerber kommuniziert, um Fairness zu gewährleisten und Überraschungen zu vermeiden. Neben der technischen Gestaltung bleibt auch die Verstärkung von realen Datenpunkten entscheidend.
Referenzen, vorherige Projekte und konkrete Arbeitserfahrungen liefern zusätzliche Informationen, die dabei helfen, die Ergebnisse aus den Interviewprozessen zu validieren und den Einfluss von KI-gestützter Prüfung auszugleichen. Aus dem historischen Blickwinkel betrachtet, erinnern heutige Diskussionen über technische Interviews und KI an einen Dialog von Plato vor über 2.300 Jahren, in dem auf die Bedeutung von Wissen und dessen Erwerb hingewiesen wird. Das heutige Zeitalter fordert neue Antworten auf die Frage, wie Wissen geprüft und verstanden wird, besonders wenn bewährte Methoden durch Technologie herausgefordert werden. Für Bewerber bedeutet das, sich nicht auf die Tools zu verlassen, sondern deren Nutzen mit eigenem Urteilsvermögen, kritischem Denken und problemorientiertem Handeln zu verbinden.