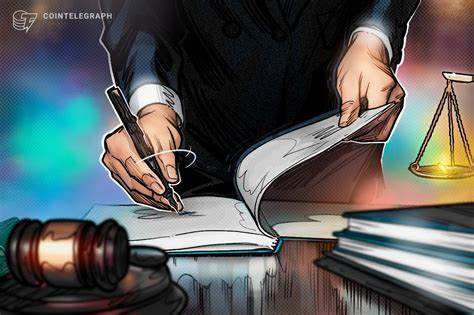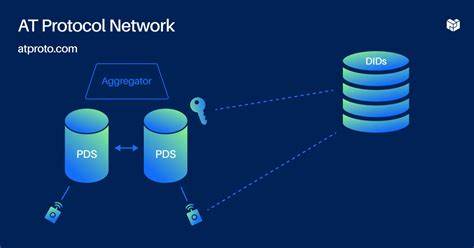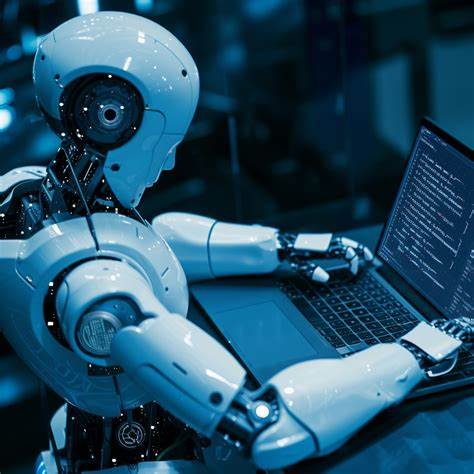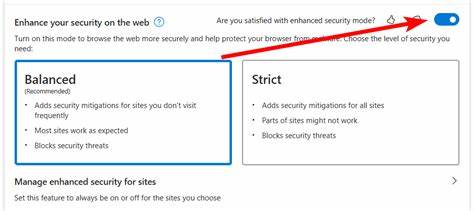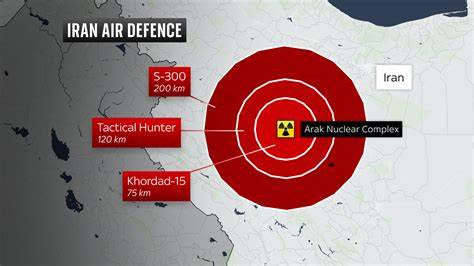Am 28. April 2025 kam es in Spanien und Portugal zu einem großflächigen Stromausfall, der Millionen Menschen betraf und zahlreiche Spekulationen über die Ursachen hervorrief. Während viele zunächst die hohen Anteile erneuerbarer Energien – Solar- und Windkraft machten knapp 40 Prozent der Stromproduktion aus – für den Blackout verantwortlich machten, zeichnet sich mittlerweile ein differenzierteres Bild ab. Experten und offizielle Untersuchungen deuten darauf hin, dass weniger die erneuerbaren Energien selbst als vielmehr die veralteten Betreiberregeln und der Mangel an koordinierter Blindleistungssteuerung für den Zusammenbruch des Netzes ausschlaggebend waren.Blindleistung ist ein oft unterschätzter, aber essenzieller Aspekt der Stromübertragung in Wechselstromnetzen.
Sie entsteht, wenn Stromfluss und Spannung nicht synchron laufen, was in jedem Stromnetz vorkommt. Blindleistung unterstützt den Transport der eigentlichen Nutzleistung über weite Strecken und stabilisiert die Netzspannung. Besonders wenn viele dezentrale regenerative Anlagen ins Netz einspeisen, ändert sich das Zusammenspiel und die Fließrichtung der Blindleistung, was neue Herausforderungen für die Netzbetreiber schafft. Im Fall des iberischen Netzes konnten viele Kraftwerke, die eigentlich zur Blindleistungsregelung verpflichtet sind, diese Funktion nicht zuverlässig erfüllen. Einige spornten sogar eine Erhöhung der Netzspannung anstatt deren Senkung an, was zu einer gefährlichen Überspannung führte.
Das bestehende Regelwerk, insbesondere das seit 25 Jahren unveränderte Operational Procedure 7.4, war weder auf die Zunahme von dezentrale Einspeisungen noch auf moderne Blindleistungsmanagement-Anforderungen ausgelegt. Eine seit Jahren in der nationalen Regulierungsbehörde liegende Überarbeitung dieser Vorschrift - dringend notwendig für eine adäquate Spannungsstabilisierung - blieb lange unvollendet. Insbesondere wurden viele erneuerbare Anlagen von der Pflicht entbunden, auf Überspannung zu reagieren oder Blindleistung bereitzustellen, was angesichts des weiterhin stark angewachsenen Anteils von Solar- und Windenergie kaum noch tragbar ist. Dies führte dazu, dass das modern aufgebaute Netz auf veralteten Betriebsbedingungen basierte und bei der kritischen Ereigniskette versagte.
Die dynamischen Spannungsoszillationen, die bereits Tage vor dem Blackout gemessen wurden, deuteten auf ein Ungleichgewicht in der Blindleistungsverteilung hin. Solch instabile Spannungsverhältnisse können sich in Windeseile über ein eng verknüpftes Stromnetz ausbreiten und bei mangelhafter Gegensteuerung zu Kettenreaktionen führen. Mehrere konventionelle Kraftwerke reagierten dabei unzureichend oder schalteten sich frühzeitig ab, was die Spannungsspitzen noch verstärkte und weitere Anlagen ausfallen ließ.Ein weiteres strukturelles Problem ist die vergleichsweise geringe Netzanbindung Spaniens und Portugals an Nachbarländer. Während die Europäische Union einen Interkonnektivitätsgrad von mindestens zehn Prozent empfiehlt, liegt der Wert auf der Iberischen Halbinsel bei nur etwa zwei Prozent.
Dies erschwert es, Lasten schnell umzuverteilen oder im Krisenfall Unterstützung von außen zu erhalten, was die Netzstabilität zusätzlich einschränkt.Zukunftsorientierte Maßnahmen zielen daher nicht nur auf eine Überarbeitung der Netzregeln ab, sondern ebenso auf den Ausbau von Speicherkapazitäten und intelligente Netzsteuerung. Speicher, etwa in Form von Batteriesystemen oder Pumpspeicherkraftwerken, können überschüssige Blindleistung abfangen und Energie bei Bedarf wieder einspeisen, was die Netzspannung stabilisiert. Obwohl Spanien derzeit an der Erweiterung der Speicherkapazitäten arbeitet, stehen diesen Projekten bislang nur ca. 3 Gigawatt einer Gesamtnetzkapaizität von rund 129 Gigawatt gegenüber, was angesichts der Netzauslastung noch zu gering ist.
Innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) können außerdem zukünftig schnelle, automatisierte Entscheidungen zur Netzstabilisierung ermöglichen. Projekte wie AI4RealNet erforschen, wie KI Netzbetreibern helfen kann, bei Störungen rasch Gegenmaßnahmen einzuleiten und dadurch Blackouts zu verhindern oder deren Ausmaß zu begrenzen. Allerdings sehen Experten KI vor allem als Unterstützung und nicht als alleinige Lösung, da viele strukturelle und regulatorische Veränderungen ebenfalls notwendig sind.Die Situation auf der Iberischen Halbinsel illustriert exemplarisch, dass die Herausforderungen moderner Energiesysteme nicht allein durch die Umstellung auf erneuerbare Energien entstehen. Vielmehr kommt es darauf an, das Netzmanagement und die Betriebsregeln an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
Die Balance von Blind- und Wirkleistung, angepasste Spannungsregelungen und eine verbesserte Netzinfrastruktur sind Schlüssel, um die Versorgungssicherheit in einer zunehmend dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung zu gewährleisten.Das Beispiel zeigt auch, dass die Integration von Photovoltaik und Windenergie nicht per se riskanter ist, sondern dass fehlende oder unzureichende Regelungen und technische Ausstattung für Defizite und Ausfälle verantwortlich sind. Länder wie Deutschland, Japan oder Österreich haben bereits mit der Regulierung von Blindleistung und der Einbindung von erneuerbaren Anlagen in die Netzstabilisierung wichtige Lektionen gezogen. Spanien und Portugal stehen nun an einem Punkt, an dem sie diese Erfahrungen aufgreifen und ihr Netz fit machen müssen für die Zukunft.Langfristig wird die Iberische Halbinsel von einem stärkeren europäischen Verbund profitieren, der durch höhere Interkonnektivität und gemeinsame Netzstandards eine stabilere und resilientere Stromversorgung ermöglicht.
Bis dahin liegt jedoch der Schwerpunkt auf der Erneuerung der Betriebsprozeduren, dem Ausbau von Speichern, der verbesserten Einbindung von erneuerbaren Erzeugern in die Blindleistungsregelung und der Förderung innovativer Steuerungstechnologien.Die Lehren aus dem Blackout sind eindeutig: Moderne Stromnetze benötigen aktualisierte und agile Regeln, die den Wandel zu nachhaltiger, dezentraler Energieerzeugung widerspiegeln. Innovationen bei Technik und Regulierung sind unerlässlich, um Versorgungssicherheit und Netzstabilität zu garantieren und so zukünftige Ausfälle zu vermeiden. Die Bemühungen der Nachbarländer und europäischer Institutionen spielen dabei eine zentrale Rolle, um die Herausforderungen in einer zunehmend komplexen Energielandschaft zu meistern und den Übergang zu einer klimafreundlichen Energieversorgung sicher zu gestalten.