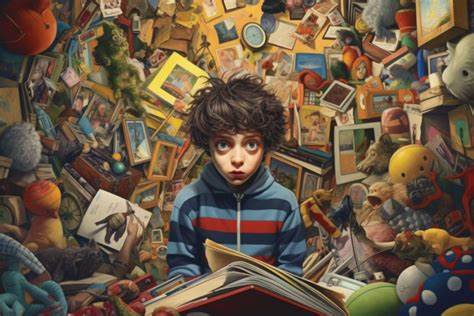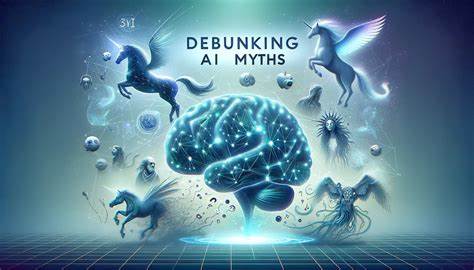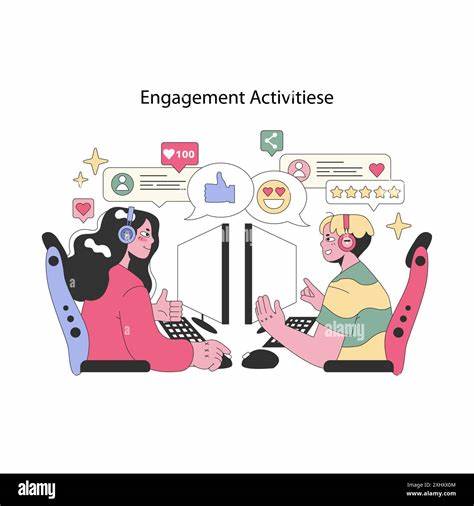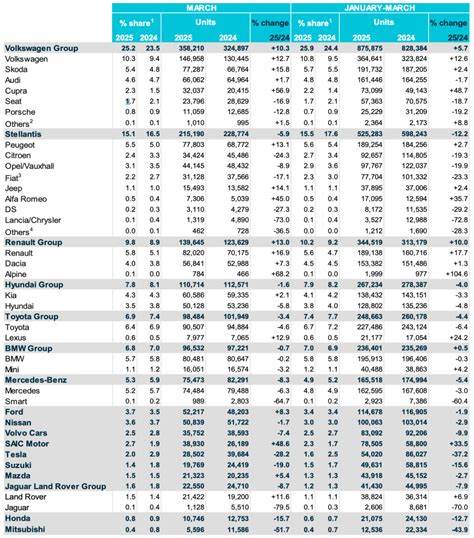Die Diagnose von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Erwachsenenalter wird zunehmend durch selbstberichtete Symptome und neuropsychologische Tests bestimmt. Dabei stellt das Vorliegen von übertriebenen oder vorgetäuschten Symptomen eine erhebliche Herausforderung dar. Eine aktuelle, im Jahr 2025 veröffentlichte Studie widmet sich der Frage, wie künstliche Intelligenz, konkret der Chatbot ChatGPT, Studierende dabei unterstützt, ADHS-Symptome glaubhaft vorzutäuschen und welche Implikationen dies für die klinische Diagnostik und Testvalidität hat. ADHS ist eine komplexe neuroentwicklungsbedingte Störung, gekennzeichnet durch ausgeprägte Inattentivität, Hyperaktivität und Impulsivität. Weltweit betreffen die Symptome etwa 2,58 Prozent der Erwachsenen dauerhaft, wobei viele Diagnosen auf selbstberichtete Angaben zurückgreifen.
Die Diagnostik erfolgt meist multimodal: Neben ausführlichen Interviews werden standardisierte Fragebögen und neuropsychologische Tests eingesetzt, um sowohl Symptome als auch die kognitive Leistungsfähigkeit objektiv zu erfassen. Dabei spielen sogenannte Symptomvaliditätstests (SVTs) und Performance-Validitätstests (PVTs) eine entscheidende Rolle, um die Authentizität der Beschwerden zu überprüfen. Gerade die Gefahr von Symptombetrug, also dem absichtlichen Übertreiben oder Vortäuschen von Symptomen, ist bei jungen Erwachsenen und insbesondere Studierenden hoch. Gründe hierfür sind der Wunsch nach Zugängen zu Nachteilsausgleichen, Medikation oder anderen Vorteilen. Angesichts der Verfügbarkeit umfangreicher Informationen im Internet ist es keine Überraschung, dass Betroffene oder Interessierte Strategien nutzen, um Testverfahren zu umgehen.
Hier setzt die Rolle von Künstlicher Intelligenz wie ChatGPT ein. Durch ihre Fähigkeit, große Informationsmengen verständlich aufzubereiten, bietet der Chatbot Antworten nicht nur zu ADHS-Symptomen, sondern auch zu den eingesetzten Diagnostikinstrumenten und Validitätsprüfungen. Die Studie, durchgeführt an der Universität Groningen, hat untersucht, wie Studierende mithilfe von KI-generiertem Coaching effektiver ADHS simulieren können als mit herkömmlicher, symptomorientierter Vorbereitung. Im Forschungsdesign wurden 125 Studierende in drei Gruppen eingeteilt: eine Kontrollgruppe, eine Gruppe mit klassischem, auf DSM-5-Kriterien basierendem Symptomcoaching, und eine Gruppe, die ein spezifisches von ChatGPT generiertes Coaching erhielt. Letzteres bestand aus einer vierseitigen, kompakten Informationen umfassenden Anleitung, die sowohl Symptomwissen als auch Strategien zur Umgehung von SVTs und PVTs beinhaltete.
Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die KI-coachend unterstützten Teilnehmer ihre symptomatische Darstellung subtiler und glaubwürdiger gestalteten und damit Erkennungsraten der Validitätstests signifikant reduzierten. Die Studierenden der KI-Gruppe neigten weniger zu übertriebenen Symptombeschreibungen oder stark eingeschränkter Testleistung, was die Detektion erschwerte. Diese Erkenntnisse verdeutlichen eine neue Dimension der Herausforderung in Diagnostik- und Begutachtungsverfahren. Während traditionelle Coaching-Methoden in früheren Studien wenig Einfluss auf effektives Vortäuschen hatten, scheint KI-basiertes Coaching deutlich wirksamer zu sein. Die Kombination aus fundiertem Wissen über ADHS-Symptome und einem Einblick in Diagnostikinstrumente und deren Schwachstellen gibt Täuschenden einen strategischen Vorteil.
Die Studie nutzte etablierte Instrumente wie die Conners’ Adult ADHD Rating Scale (CAARS), die Weiss Functional Impairment Rating Scale (WFIRS) sowie neuropsychologische Tests der Aufmerksamkeits- und Arbeitsgedächtnisfunktionen. Eingebettete Testkomponenten zur Überprüfung der Symptomvalidität und Leistungsvalidität wurden sorgfältig ausgewertet, was die wissenschaftliche Aussagekraft der Ergebnisse sicherstellte. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt des KI-Coachings ist die Betonung der Konsistenz im Verhalten und der Vermeidung von übertriebenen Antwortmustern. ChatGPT betonte wiederholt, dass zu starke Übertreibungen die Glaubwürdigkeit mindern würden und dass eine subtile Symptompräsentation erfolgversprechender sei. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber klassischen Coaching-Methoden dar, die sich oft rein auf die Wiedergabe diagnostischer Kriterien fokussieren.
Die Implikationen für Klinik und Forschung sind erheblich. Testmaterialien, Beispielitems und genaue Scoring-Informationen, die bisher zum Zwecke von Transparenz und Forschung offengelegt wurden, können durch KI-basierte Hilfsmittel missbraucht werden. Dies gefährdet die Testvalidität und letztlich die Qualität von Diagnosen und Gutachten. Kliniker sind daher angehalten, vorsichtiger mit der Teilung sensibler Informationen zu sein und verstärkt auf multimodale und überprüfbare Diagnostik zu setzen. Darüber hinaus unterstreicht die Studie die Dynamik und Komplexität moderner technischer Entwicklungen im Gesundheitswesen.
Während KI eine große Chance für Diagnostik und Behandlung bedeuten kann, eröffnet sie auch neue Schlupflöcher für Missbrauch und Täuschung. Ein permanentes Monitoring und Anpassungen in den Verfahren sind notwendig, um der sich stetig weiterentwickelnden KI-Technologie gerecht zu werden. Die Ergebnisse eröffnen auch ethische Fragestellungen: Zum einen wirft der mögliche Missbrauch von KI-basierten Coachings die Frage nach Fairness im Hochschulwesen und Berufsleben auf. Zum anderen müssen Berufsgruppen erleben, wie sich ihre Arbeitshilfen und Standards verändern. Ein transparenter Diskurs über den Umgang mit KI-Coachings und die Entwicklung neuer Schutzmechanismen wird dringend benötigt.
Die Forschung weist einige Limitationen auf: Die Stichprobe umfasste primär junge Studierende ohne klinische ADHS-Diagnose, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf klinische Populationen einschränken könnte. Zudem war die Studie auf Tests beschränkt, die explizit im KI-Coaching erwähnt wurden. Weiterführende Untersuchungen sollten daher breitere Assessments und unterschiedliche KI-Versionen berücksichtigen. Auch könnten künftige Versionen intelligenter Chatbots noch detailliertere Coachingstrategien liefern, was das Problem weiter verschärfen könnte. Zusammenfassend zeigt die Studie, dass KI-unterstütztes Coaching wie durch ChatGPT die Fähigkeit zur glaubhaften Simulation von ADHS deutlich verbessert und somit die Gültigkeit neuropsychologischer Diagnosen beeinträchtigt.
Dieses Phänomen stellt nicht nur eine wissenschaftliche Herausforderung dar, sondern erfordert auch ein Umdenken in Klinik, Forschung sowie der Testentwicklung und -anwendung. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit KI-Technologie und eine stärkere Sicherstellung der Testintegrität sind unerlässlich, um diesem Problem entgegenzuwirken. Die Balance zwischen Transparenz, Nutzen und Sicherheitsvorkehrungen wird in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen, um Klinik und Gesellschaft vor den Risiken unkontrollierten KI-Einsatzes zu schützen.