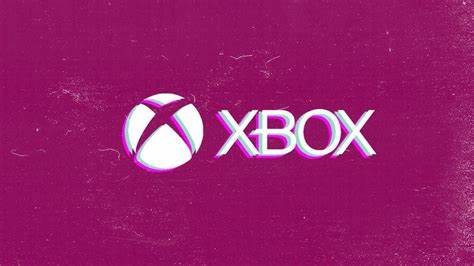Die Nuklearindustrie steht am Beginn einer neuen Ära, in der bewährte und zugleich lange vernachlässigte Technologien wieder an Bedeutung gewinnen. Besonders beeindruckend ist die Renaissance der Thorium-basierten Reaktoren, eine Technologie, die ursprünglich in den Vereinigten Staaten in den 1950er und 1960er Jahren entwickelt wurde, heute aber vor allem in China eine beeindruckende Wiederbelebung erfährt. Die asiatische Großmacht investiert kräftig in Forschung und Entwicklung, um alternative Kernreaktoren in den Energiemix zu integrieren und sich als weltweiter Vorreiter bei sauberer, sicherer und nachhaltiger Atomenergie zu positionieren. Diese Entwicklung bringt nicht nur neue Hoffnung für die Energieversorgung der Zukunft, sondern wirft auch einen Blick zurück auf eine Technologie, die in den USA aus politischen, wirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Gründen in den Hintergrund gedrängt wurde. Thorium, ein natürlich vorkommendes radioaktives Metall, gilt als vielversprechender Brennstoff für Kernreaktoren.
Im Gegensatz zum häufig verwendeten Uran bietet Thorium einige entscheidende Vorteile: Seine Verfügbarkeit ist deutlich höher, die Energieausbeute pro Masseneinheit ist größer und das Risiko der Proliferation – also der Weiterverbreitung von spaltbarem Material zur Herstellung von Atomwaffen – ist geringer. Genau dieser Aspekt erklärt, warum Thorium technologische Entwicklungen im 20. Jahrhundert immer wieder behindert wurden. Denn die zivile Nutzung von Kernenergie war historisch eng mit der Entwicklung von Atomwaffen verbunden, weshalb Regierungen sich auf den Uranbetrieb konzentrierten. China bricht mit dieser Tradition und beschreitet neue Wege.
Das Land baute im Juni 2024 einen Thorium-Reaktor mit einer bislang einzigartigen Eigenschaft in der Nuklearbranche: Das Experiment wurde ohne Abschalten des Reaktors neu betrieben, was bedeutet, dass der Brennstoff während des Betriebs ausgetauscht werden kann. Dieses Verfahren erhöht die Effizienz und minimiert die Stillstandszeiten von Reaktoren, eine Herausforderung, mit der konventionelle Uranreaktoren oft zu kämpfen haben. Die kurzen Stillstandsintervalle sind nicht nur ökonomisch attraktiv, sondern auch ein Fortschritt hinsichtlich der Betriebssicherheit und Flexibilität. Die chinesischen Forscher berichteten über diese technischen Meilensteine auf einer Sitzung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Obwohl die Kapazität des laufenden Thorium-Reaktors mit nur zwei Megawatt thermisch vergleichsweise gering ist – noch kleiner als der MIT-Forschungsreaktor, der etwa sechs Megawatt leistet – markiert er einen wichtigen Schritt im Forschungsprozess.
Es zeigt, dass China nicht nur auf konventionelle, auf Uran basierende Großreaktoren setzt, sondern auch visionäre, kleinere und technisch fortgeschrittene Anlagen baut, die den Energiemarkt langfristig nachhaltig verändern können. Während China heute der bedeutendste Akteur im weltweiten Ausbau der Kernenergie ist, hat das Land auch große Anstrengungen unternommen, um fortschrittliche Reaktorkonzepte voranzutreiben. Darunter fallen Hochtemperaturreaktoren mit gasgekühlten Systemen sowie modular aufgebaute kleine Reaktoren, die eine höhere Flexibilität und geringeren Sicherheitsaufwand versprechen als konventionelle Großkraftwerke. Vor allem die Kombination aus Thorium als Brennstoff und modernen Kühltechnologien könnte die Energieerzeugung revolutionieren, indem sie effizienter, sicherer und umweltfreundlicher gestaltet wird. Auf der historischen Ebene fällt auf, dass die ursprünglich im US-amerikanischen Oak Ridge National Laboratory durchgeführten Thorium-Experimente in den 1960er Jahren eine höchst innovative Entwicklung darstellten.
Dort wurde Uran-233 als Brennstoff eingesetzt, hergestellt durch Bestrahlung von Thorium. Der vielversprechende Ansatz, der in dieser Zeit viele Forschungskapazitäten anzog, geriet mit der Zeit in den Hintergrund, als sich die Kernenergiepolitik weltweit zunehmend auf Uran-238 und dessen Isotope als Brennstoff konzentrierte. Dieses Festhalten an der etablierten Reaktortechnik führte zu einem Stillstand in der Weiterentwicklung alternativer Kerntechnologien, der sich bis ins 21. Jahrhundert fortsetzte. China durchbricht nun die jahrzehntelange Stagnation.
Die Wiederaufnahme der Thoriumforschung ist Teil eines größeren strategischen Plans, der China als führenden Nuklearenergieproduzenten positionieren soll. Durch massive Investitionen in die Errichtung neuer Anlagen und in die Forschung entstehen mehrere laufende Projekte, die parallel an State-of-the-Art- und alternativen Kernreaktorkonzepten arbeiten. Die Genehmigung von zehn neuen Reaktoren mit einem Investitionsvolumen von über 27 Milliarden US-Dollar allein in kurzer Zeit unterstreicht die große Ambition Pekings. Neben Thorium erlebt auch die längst vergessene Technologie des Molten-Salt-Reaktors eine Wiederbelebung. Diese Reaktoren nutzen geschmolzenes Salz als Kühlmittel, was einige technische Vorteile gegenüber herkömmlichen wassergekühlten Reaktoren verspricht, darunter höhere Betriebstemperaturen, verbesserte Sicherheit und effizientere Nutzung des Brennstoffs.
Trotz der Probleme mit der Korrosivität des Salzes, die bisher eine kommerzielle Umsetzung erschwerten, investieren Unternehmen weltweit, darunter in den USA und China, nun wieder massiv in diese Technologie. Die Kombination aus Thoriumbrennstoff und Molten-Salt-Technologie erscheint als besonders vielversprechend für die Zukunft der Kernkraft. Die Wiederkehr dieser Technologien zeigt, dass die Kernenergieforschung zunehmend zurückblickt, um aus früheren Innovationen neues Potenzial zu schöpfen. Jahrzehntelang wurden viele Ansätze als zu experimentell oder wirtschaftlich nicht attraktiv verworfen, doch der dringende weltweite Bedarf an klimaneutraler Energiezufuhr und die Weiterentwicklung der Materialwissenschaften schaffen heute neue Voraussetzungen für eine zweite Chance dieser Technologien. Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Flexibilität der neuen Reaktor-Designs.
Kleine modulare Reaktoren (SMRs), die häufig auf Thorium basieren, haben den Vorteil, dass sie weniger Flächenbedarf haben, schneller gebaut werden können und aufgrund ihrer geringeren Leistung auch in weniger stabilen Netzen betrieben werden können. Dies ist besonders relevant für Schwellenländer und aufstrebende Volkswirtschaften, die schnell an ihre Energieversorgungskapazitäten kommen wollen, ohne in groß dimensionierte Kernkraftwerke investieren zu müssen. Trotz der Fortschritte stehen Thorium-Reaktoren noch vor einigen Herausforderungen. Die Umwandlung von Thorium in spaltbares Uran-233 ist komplex und erfordert spezialisierte Technologien. Auch regulatorische Hürden und die Entwicklung passender Sicherheitsstandards müssen überwunden werden.
Der Umgang mit radioaktiven Abfällen und potenzielle Umweltrisiken sind ebenfalls Themen, zu denen intensive Forschung nötig ist. Dennoch verspricht die Nutzung von Thorium gegenüber Uran eine verringertes Risiko bei der Langzeitlagerung und geringere Mengen an langlebigem radioaktivem Müll. China verfolgt mit seiner Nuklearstrategie somit eine Doppellinie: Einerseits setzt es auf bewährte Großreaktortechnologien zur schnellen Expansion der Energieproduktion, andererseits investiert es in die experimentelle und fortschrittliche Forschung. Die Thoriumreaktoren sind ein sichtbares Signal für diese Zukunftsstrategie und bieten den Blick auf eine potenzielle Revolution der globalen Energieversorgung. Diese Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der die Welt vor tiefgreifenden ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen steht.
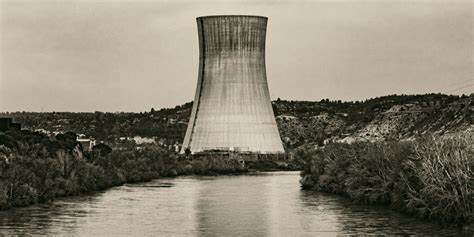


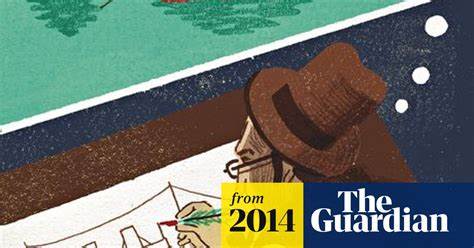
![Stargate Data Center being built in Abilene, Texas [video]](/images/FA009368-EC5D-48C3-BCAC-AF0B85F4678C)