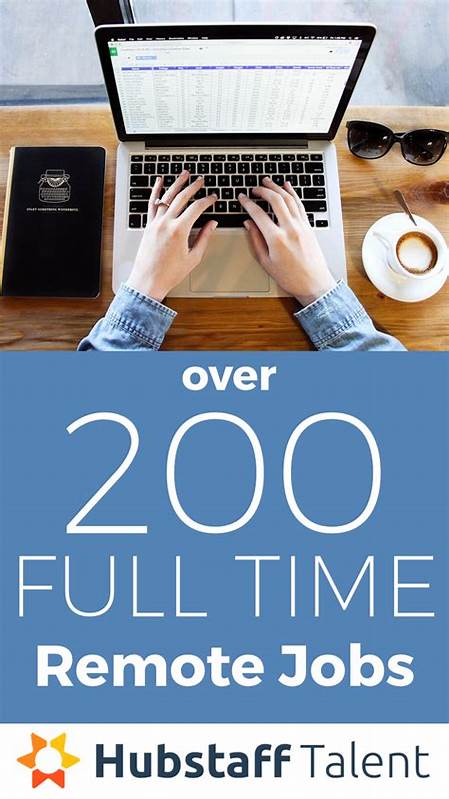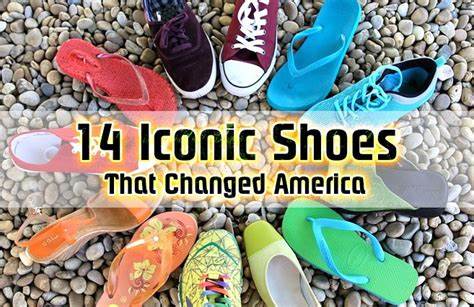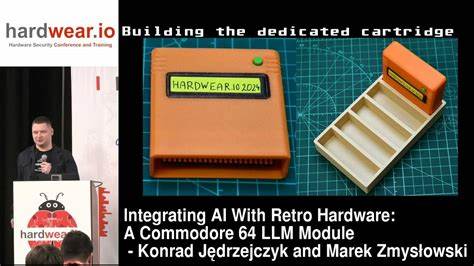Inmitten globaler wirtschaftlicher Spannungen hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump einen neuen Plan vorgestellt, der die Filmindustrie kräftig durchschütteln könnte: Die Einführung eines 100-prozentigen Importzolls auf Filme, die außerhalb der Vereinigten Staaten produziert werden. Diese Ankündigung hat weitreichende Diskussionen ausgelöst, da Hollywood traditionell international ausgerichtet ist und viele Produktionen in Ländern mit attraktiven steuerlichen Anreizen und günstigeren Produktionskosten entstehen. Trumps Entscheidung basiert auf der Überzeugung, dass die Verlagerung der Filmproduktion ins Ausland eine Bedrohung für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Stärke der USA darstellt. Doch was bedeutet diese Maßnahme in der Praxis, und wie reagieren Filmstudios und internationale Partner darauf? Trump bezeichnet die sogenannte »runaway production«, also die Abwanderung von Filmproduktionen ins Ausland, als »nationale Sicherheitsbedrohung«. Er argumentiert, dass andere Länder durch großzügige finanzielle Anreize amerikanische Filmschaffende ins Ausland locken und so die inländische Industrie schwächen.
Laut Trump ist die amerikanische Filmindustrie »schnell dabei zu sterben«, wobei Hollywood und viele weitere US-Regionen durch diese Entwicklung massiv leiden. Um dagegen anzugehen, fordert er eine rigorose Zollpolitik, die alle ausländisch produzierten Filme einer Verdoppelung des Preises durch Einfuhrzölle unterwirft. Die Hintergründe für diese Politik sind vielschichtig. Hollywood zählt seit langem zu den bedeutendsten Wirtschaftssektoren der USA. Neben der kulturellen Bedeutung generiert die Branche Milliardenumsätze – sowohl im Inland als auch international.
Doch um Kosten zu sparen und von steuerlichen Förderungen zu profitieren, verlagern viele große Produktionen zumindest Teile des Drehs oder der Nachbearbeitung ins Ausland. Länder wie Kanada, Großbritannien, Australien und Ungarn bieten umfangreiche Subventionen und günstige Rahmenbedingungen, was amerikanischen Studios hilft, Budget einzusparen. Diese Praxis hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen und führte zu einem spürbaren Rückgang der Produktionen auf heimischem Boden. Trump sieht in der Abwanderung von Produktionen einen Angriff auf die amerikanische wirtschaftliche Basis und symbolisch eine Schwächung der kulturellen Souveränität. Er hebt auch die Rolle von Unterstützungsprogrammen ausländischer Regierungen hervor, die die amerikanische Konkurrenz weiter schwächen könnten.
Für Trump ist das nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch ein strategisches, denn er betrachtet die Filmindustrie als wichtigen Faktor für Soft Power und nationale Identität. Allerdings stößt der Plan, 100 Prozent Zölle auf Filme aus dem Ausland zu erheben, auf erhebliche Skepsis und Kritik, auch in den Reihen von Experten und Beteiligten aus der Filmbranche. Zum einen sind viele Projekte heutzutage hybride Produktionen, die teilweise in den USA, teilweise im Ausland entstehen. Unklar ist, ob und wie ein Zoll für solch segmentierte Produktionen angewandt werden könnte. Ein weiterer Punkt ist die Zugehörigkeit von Produktionsfirmen.
Obwohl viele Filme außerhalb der USA gedreht werden, stammen wesentliche finanzielle Investitionen, Rechte und Management oft von US-amerikanischen Studios. Die genaue Definition dessen, was als »auslandsproduzierte« Filme gelten soll, ist daher höchst komplex und wirft juristische Fragestellungen auf. Hinzu kommt, dass die US-amerikanische Regierung selbst laut World Trade Organization (WTO)-Regeln gewisse Einschränkungen umsetzen muss, zum Beispiel aufgrund eines Moratoriums für digitale Güter, das aktuell noch bis 2026 gilt. Die Filmindustrie, vor allem im Bereich von Streaming und digitalen Medien, bewegt sich zunehmend im Bereich solcher digitaler Produkte. Es bleibt also offen, wie praktikabel eine Zollerhebung in diesem sensiblen Bereich sein wird.
Darüber hinaus könnten andere Länder als Reaktion eigene Gegenmaßnahmen einführen und beispielsweise die Einfuhr von amerikanischen Filmen limitieren oder besteuern. Dies hätte potenziell negative Folgen für die Umsätze von Hollywood, die zu einem großen Teil vom internationalen Publikum abhängen. Im Jahr 2024 etwa stammte ein deutlicher Anteil der Einnahmen großer Studios aus dem Ausland, was die globale Verflechtung der Branche verdeutlicht. Eine Eskalation könnte also auch wirtschaftliche Risiken für die amerikanische Filmindustrie mit sich bringen. Die Filmbranche selbst hat gemischte Reaktionen gezeigt.
Während einige Gewerkschaftsvertreter sich für eine stärkere Förderung und steuerliche Anreize im Inland aussprechen, nutzten viele Studios bisher die Vorteile internationaler Kooperationen. Die Gründe für Out-of-Home-Drehs sind vielfältig: Neben Kostenersparnis spielen auch kreative und logistische Aspekte eine Rolle, etwa spezielle Landschaften oder technische Einrichtungen. Die Krise in der heimischen Produktion bleibt daher komplexer als eine reine Kostenfrage. Der Schauspieler Jon Voight, als einer von Trumps Hollywood-Sonderbotschaftern genannt, hat eigene Vorschläge für eine Erholung des amerikanischen Filmsystems eingebracht. Er plädiert für bundeseinheitliche Steueranreize, die die bisherigen staatlichen Förderungen ergänzen sollten, um die Produktionen vermehrt in den USA zu halten.
Neben wirtschaftlichen Vorteilen für Schaffende und Arbeiter stünde auch der Erhalt des kulturellen Erbes und von Arbeitsplätzen im Fokus. Kritiker bezeichnen Trumps Zollpläne als unrealistisch und kontraproduktiv. Einige Experten weisen darauf hin, dass eine Zollerhebung nicht automatisch dazu führt, dass Produktionen wieder in den USA stattfinden. Auch der Präsident der Motion Picture Association hielt sich bisher mit Kommentaren zurück, wohl auch aus Sorge um die Auswirkungen auf die Industrie und deren internationale Kooperationen. Einige Ökonomen sehen in der Maßnahme eher eine populistische Geste, die die Komplexität der globalisierten Filmproduktion unterschätzt.
Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Annahme, dass andere Länder »unfaire« Unterstützungen leisten würden, während die vernetzte Filmwelt viel stärker von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist. Hinzu kommt, dass die Filmindustrie trotz Trumps Kritik bisher auch positive Handelsbilanzen vorweisen kann. Laut offiziellen Zahlen der Motion Picture Association erzeugt die Branche mehr Exporte als Importe und trägt somit zum wirtschaftlichen Wachstum bei. Die Frage, wie die Produktion amerikanischer Filme künftig bewahrt und gestärkt werden kann, bleibt daher im Mittelpunkt der Debatte. Neben staatlichen Eingriffen stehen auch der technologische Wandel, Digitalisierung und die Verschiebung der Konsumgewohnheiten auf Plattformen wie Netflix oder Disney+ im Fokus.
Viele von ihnen ziehen es vor, Teile ihrer Produktionen im Ausland durchzuführen, auch weil dort Innovationen und Produktionskapazitäten aufgebaut wurden. Insgesamt zeigt sich, dass Trumps Plan, 100% Zölle auf ausländische Filme einzuführen, symptomatisch ist für die aktuellen Spannungen zwischen protektionistischer Politik und globalisierter Wirtschaft. Hollywood steht hier exemplarisch für den Konflikt zwischen nationalen Interessen und internationaler Marktvernetzung. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen hinaus wirft die Debatte auch grundsätzliche Fragen darüber auf, wie kulturelle Produktionen in einer vernetzten Welt bewahrt und gefördert werden können. Ob Trumps Initiative tatsächlich umgesetzt wird oder im politischen Prozess scheitert, bleibt abzuwarten.