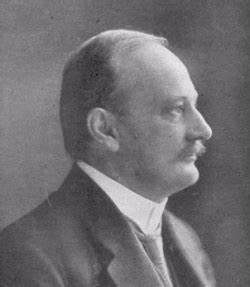Die Entstehung der Atombombe zählt zu den bedeutendsten wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Weniger bekannt ist jedoch die teilweise kuriose und faszinierende Lage der Hauptakteure dieses Projekts in Bezug auf ihre Herkunft. Es gibt eine humorvolle, aber nicht völlig abwegige Sichtweise, die besagt, dass die Grundlagen für die Atombombe eigentlich als ein „ungarisches Highschool-Wissenschaftsprojekt“ verstanden werden können – insbesondere aufgrund der ungewöhnlich hohen Konzentration von ungarisch-jüdischen Genies, die am Manhattan-Projekt mitwirkten. Diese Geschichte beginnt in Budapest, wo in der Zeit zwischen 1890 und 1920 eine Vielzahl von außergewöhnlich begabten Physikern, Mathematikern und Wissenschaftlern geboren wurde, die später wegweisende Beiträge zur Quantenmechanik, Kernphysik und zur Entwicklung der Atombombe leisteten.
Namen wie Leo Szilard, Edward Teller, Eugene Wigner und John von Neumann sind untrennbar mit der Entstehung der Kernwaffen verbunden und haben gemeinsam, dass sie in ungarischen Schulen ausgebildet wurden – insbesondere an Gymnasien in Budapest. Ein Witz unter Physikern besagt daher auch, die Atombombe sei nichts anderes als ein ungarisches Highschool-Wissenschaftsprojekt. Hintergrund dieses Spitznamens ist eine Anekdote, die einen fiktiven Ursprung der genialen Forscher im Umfeld einer Gruppe von außerirdischen Marsianern vermutet, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Budapest stationiert gewesen sein sollen. Der Witz spielt auf das außergewöhnliche Niveau und die geballte Intelligenz dieser ungarischen Wissenschaftler an, die oftmals jüdischer Herkunft waren.
Sie waren in der Tat einzigartig – nicht nur wegen ihrer individuellen Brillanz, sondern auch wegen der außergewöhnlichen sozialen, kulturellen und bildungspolitischen Voraussetzungen, unter denen sie aufwuchsen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte Budapest eine Blütezeit als Zentrum von Wissenschaft, Bildung und Kultur innerhalb des Habsburgerreiches. Die Stadt hatte einen außergewöhnlich hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, der im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten bemerkenswert war. Diese jüdische Gemeinschaft pflegte eine soziokulturelle Tradition, die Bildung hoch schätzte, insbesondere naturwissenschaftliche und mathematische Ausbildung.
Neben einer strengen Erziehung wurde auch ein Wettbewerbsgedanke durch zahlreiche Mathematik- und Physikwettbewerbe gefördert, die junge Talente entdeckten und förderten. Ein entscheidender Einflussfaktor war das ungarische Bildungssystem jener Zeit, das trotz der politischen Widrigkeiten und sozialer Konflikte einen ausgezeichneten Ruf genoss. Die Gymnasien vermittelten eine fundierte mathematisch-naturwissenschaftliche Basis, und Lehrer wie der legendäre Laszlo Rátz wurden zu Mythen. Rátz unterrichtete einige der späteren Genies direkt, war bekannt für seine außergewöhnlichen pädagogischen Fähigkeiten und seine Leidenschaft, Talente zu fördern. Es ist ungewöhnlich und bemerkenswert, in einer Gesellschaft eine Persönlichkeit zu finden, die in hohem Maße geehrt und verehrt wird – mit Statuen, Gedenkmedaillen und internationalen Kongressen für Mathematiklehrer.
Doch die dominante Rolle von Laszlo Rátz ist nur ein Teil der Erklärung. Bei Weitem nicht alle der bedeutenden ungarischen Wissenschaftler wurden von ihm unterrichtet, und dennoch profitierte die „Fasori“ Gymnasium allgemein von einem Umfeld, das herausragende Talente anzog und förderte. Dabei spielte auch ein spezielles Klima der Kreativität und des Wettbewerbs eine Rolle. Unterschiedlichste Gymnasien, wie das „Fasori“ oder das „Minta“-Gymnasium, waren Brutstätten von Talenten, ohne dass simple Ursachen für deren Gemeinsamkeiten identifiziert werden konnten. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt dieses Phänomens ist die kulturelle und genetische Besonderheit der jüdischen Bevölkerung in Zentral- und Osteuropa – den Ashkenazim.
Hier haben Wissenschaftler wie Cochran, Hardy und Harpending in ihrer Abhandlung „A Natural History of Ashkenazi Intelligence“ faszinierende Hypothesen aufgestellt. Sie argumentieren, dass genetische Mutationen, die bei den Ashkenazi-Juden gehäuft auftreten und eigentlich als schädlich gelten, eine heterozygote Vorteilhaftigkeit besitzen, die sich in einer erhöhten durchschnittlichen Intelligenz widerspiegeln könnte. Dies erklärt zumindest teilweise, warum Ashkenazi in Wissenschaft, Technologie, Mathematik und verwandten Gebieten überproportional vertreten sind. Diese genetische Erklärung ist zudem eingebettet in einen historischen Kontext, der von sozialer Ausgrenzung, Berufsverboten und strengen Heiratsregeln geprägt war. Durch die gezielte Beschränkung auf intellektuell anspruchsvolle Berufe wie Bankwesen, Handel und Medizin wurden Personen mit höherem Verstand auf natürliche Weise bevorzugt, was zur einer positiven Selektion für Intelligenz führte.
Gleichzeitig hatten sie – entgegen landläufiger Annahmen – durchaus materielle Mittel und konnten viele Kinder großziehen, was den Evolutionsdruck weiter verstärkte. Die historischen Zahlen untermauern dies: In Budapest etwa bildeten Juden damals eine besonders hohe Bevölkerungsgruppe, die selbst in den gebildeten Schichten oft vereint auftrat. Die Mischung aus begrenztem Zugang zu gewissen Berufsfeldern, außergewöhnlicher Bildungsförderung, genetischer Selektion und einem inspirierenden kulturellen Umfeld führte zur Entstehung einer Genieschar, die schließlich die Grundlagen für moderne Wissenschaften schuf – und schlussendlich die Atombombe. Während die Atmosphäre in Budapest eine „Superbatterie“ intellektueller Talente erzeugte, wurde diese sichere Basis durch den Aufstieg der Nazis mit verheerenden Folgen zerstört. Fast alle Protagonisten der „ungarischen Wissenschaftler“-Generation wurden Opfer oder mussten fliehen.
So endete eine gelungene Episode außergewöhnlicher Bildung und Selektion fast abrupt mit der Tragödie des Holocaust. Es stellt sich jedoch die philosophische und pädagogische Frage, ob sich derartige intellektuelle Explosionen reproduzieren lassen. Die Realität ist ambivalent. Einerseits gibt es wenige anonymisierte Beispiele, die zeigen, dass außerordentlicher Bildungserfolg auch an anderen Orten und Zeiten möglich ist, wenn ein förderndes Umfeld, starke Lehrerpersönlichkeiten und Wettbewerbskultur gegeben sind. Andererseits sind heute die „low hanging fruits“ großer wissenschaftlicher Entdeckungen offensichtlich weitgehend geerntet, und der Zugang zu Topforschern verteilt sich global.
Darüber hinaus ist die Generation von Genies vielleicht nicht beliebig wiederholbar, sondern Produkt einer einmaligen Kombination aus Genetik, Kultur und Geschichte. Doch neben rein genetischen und sozialen Faktoren sind auch wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Bedingungen entscheidend. Die liberale, forschungsfreundliche Atmosphäre, politische Freiheit sowie Ressourcenverfügbarkeit sind allesamt Münzen, die das Feuer der Forschung befeuern. Die einstige Konzentration in Budapest oder Wien war auch nicht allein Folge von Genetik, sondern des Zusammenspiels vieler „Glücksströme“. In unserem heutigen Zeitalter, in dem Wissenschaft globalisiert und hoch spezialisiert ist, stellt sich die Herausforderung, dieses Potential zu erkennen und bestmöglich zu fördern.
Die vielbeschworene „ungarische Schule“ kann als Vorbild gelten: Im Kern steht ein geschickter Mix aus erstklassiger Bildung, frühen Förderprogrammen, Wettbewerb (wie Mathematikolympiaden) und einer Kultur, die Tüftlergeist und Kreativität schätzt. Die Herkunftsgeschichte der Atombombe als „ungarisches Highschool-Wissenschaftsprojekt“ ist damit weit mehr als ein Witz. Sie ist eine Erinnerung daran, wie besondere Bildungs- und Sozialstrukturen, kombiniert mit einzigartigen historischen und genetischen Bedingungen, Innovationen ermöglichen können, die die Welt grundlegend verändern – und wie fragil und bedrohlich diese Errungenschaften angesichts politischer und sozialer Unruhen sind. Wenn wir also den Blick nach vorne richten, ist die zentrale Frage: Wie können wir Kulturen schaffen, die Talente zum Blühen bringen, ohne die gesellschaftlichen Kosten dieses Schatzes zu tragen? Was können wir aus den Erfolgen und Fehlern der ungarischen Wissenschaftsväter lernen? In jedem Fall bleibt die Episode ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Wissenschaft und ein faszinierender Einblick in den Zusammenhang zwischen Schulbank und Weltpolitik.