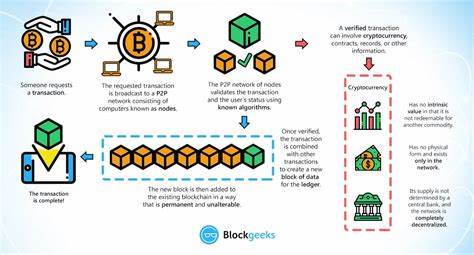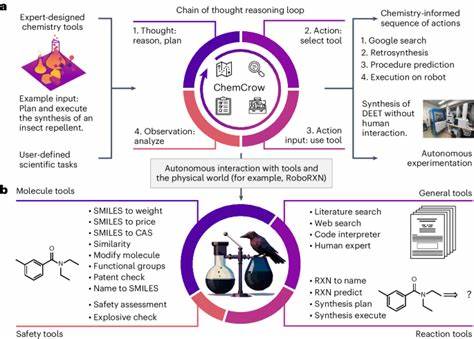Jordanien ist für viele Geflüchtete aus verschiedenen Kriegs- und Krisenregionen im Nahen Osten und Afrika ein wichtiger Zufluchtsort geworden. Besonders die schwarze Flüchtlingsgemeinschaft steht dabei oft im Schatten anderer, wie etwa syrischer Flüchtlinge, deren Notlagen internationale Aufmerksamkeit erhalten. Dennoch zeichnet sich hinter den Straßen von Amman und anderen jordanischen Städten ein komplexes Bild ab, das von Überlebenskampf, Diskriminierung, aber auch von Hoffnung und Gemeinschaft geprägt ist. Die Erfahrungen schwarzer Flüchtlinge in Jordanien offenbaren tief verwurzelte soziale Probleme ebenso wie die Herausforderungen im Umgang mit rechtlichen Unsicherheiten und mangelnder staatlicher Unterstützung.Viele schwarze Flüchtlinge stammen aus Ländern wie Sudan, Eritrea, Süd-Sudan, Somalia und verschiedenen afrikanischen Staaten, die aufgrund von Kriegen, politischer Verfolgung oder wirtschaftlicher Not zur Flucht gezwungen wurden.
Für sie ist Jordanien oft nur eine Zwischenstation, ein Durchgangsort auf dem Weg zu vermeintlich besseren Ländern im Westen oder anderswo. Die Realität vor Ort ist jedoch geprägt von einem Leben in unsteter Unsicherheit und oft erbarmungsloser Ausgrenzung. Ein typisches Bild aus Amman zeigt Ibrahim Edris, einen sudanesischen Flüchtling, der trotz der Widrigkeiten versucht, sein Leben zu meistern. Seine täglichen Begegnungen in den kleinen sudanesischen Cafés und Geschäften eröffnen Einblicke in eine lebendige, dennoch marginalisierte Gemeinschaft.Die kulturelle Identität wird für viele schwarze Flüchtlinge zu einem kostbaren Gut, das es in der Fremde zu bewahren gilt.
Die kleinen Oasen der Gemeinschaft, wie traditionelle Kaffeehäuser oder Bars, dienen als Rückzugsorte, um sich nicht nur der Heimat nahe zu fühlen, sondern auch der Diskriminierung in der breiteren jordanischen Gesellschaft zu entkommen. Die Arabische Welt, sie mag für Außenstehende oft homogen wirken, bietet jedoch vielschichtige soziale Dynamiken. Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe ist tief verwurzelt und zeigt sich in vielerlei Formen – von alltäglichem Rassismus im Straßenbild, bis zu beleidigenden Begriffen wie „abu sumrah“, einem abwertenden Ausdruck, der schwarze Menschen auf ihre Hautfarbe reduziert und ihre Individualität leugnet.Diese gesellschaftliche Ablehnung spiegelt sich auch in wirtschaftlichen Benachteiligungen wider. Schwarzafrikanische Flüchtlinge in Jordanien haben häufig keinen legalen Zugang zum Arbeitsmarkt.
Das Arbeitserlaubnis-System verweigert ihnen die reguläre Beschäftigung, was sie in die Schattenwirtschaft zwingt. Viele akzeptieren informelle und oft ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, bei denen sie unterbezahlt bleiben und kaum rechtliche Mittel gegen Missbrauch besitzen. Zahlreiche Berichte dokumentieren Fälle, in denen Arbeitgeber Lohnzahlungen verweigern, Situationen von moderner Sklaverei nicht ausgeschlossen. Besonders betroffen sind zudem Frauen aus afrikanischen Ländern, die als Hausangestellte unter teilweise unmenschlichen Bedingungen arbeiten und bei Flucht oder Protest mit Abschiebung und sogar Haftstrafen rechnen müssen.Die juristische Lage verschärft diese Situation zusätzlich.
Jordanien erkennt viele Flüchtlinge, insbesondere aus afrikanischen Ländern, nicht offiziell an. Diese fehlende Anerkennung entzieht ihnen wesentliche Rechte wie Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung oder sozialer Absicherung. Der Zulauf syrischer Flüchtlinge infolge des Bürgerkriegs seit 2011 hat die Ressourcen in Jordanien weiter belastet und zu einer Priorisierung syrischer Geflüchteter geführt, während die Bedürfnisse schwarzer Flüchtlinge zunehmend in den Hintergrund rücken. Diese Ungleichbehandlung sorgt für Frustration und das Gefühl des Vergessenseins innerhalb der afrikanischen Flüchtlingsgemeinschaft.Ein besonders erschütterndes Ereignis war die Massendeportation sudanesischer Flüchtlinge im Jahr 2015.
Nachdem zahlreiche Flüchtlinge friedlich vor der UNHCR-Zentrale in Amman für bessere Bedingungen demonstriert hatten, griff die jordanische Polizei gewaltsam ein. Über 800 Menschen wurden damals unter widrigen Umständen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht, obwohl sie dort weiterhin Lebensgefahr ausgesetzt waren. Der Vorgang stand im klaren Widerspruch zu internationalem Recht, insbesondere dem Prinzip der Nicht-Zurückweisung (Non-Refoulement), das Jordanien 1998 ratifiziert hatte. Dieses Prinzip verbietet es Ländern, Flüchtlinge in Staaten zurückzuschicken, in denen ihnen ernsthafte Gefahren drohen.Die Resonanz auf solche Menschenrechtsverletzungen ist oft schwach.
Organisationen wie die Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) oder lokale Initiativen wie Sawiyan kämpfen für die Rechte schwarzer Flüchtlinge, bieten Bildungsprogramme und organisieren gesellschaftlichen Dialog. Doch ihr Einfluss ist begrenzt. Die UNHCR, die Vereinten Nationen und jordanische Behörden zeigen sich häufig apathisch oder gar widerständig gegenüber Forderungen nach besseren Schutzmaßnahmen. Politische Restriktionen, wie die von manchen westlichen Ländern verhängten Reiseverbote, erschweren zudem die Ausreise und Resettlement-Möglichkeiten der Flüchtlinge.Dennoch gibt es inmitten dieser Schwierigkeiten Hoffnung.
Begegnungen in Gemeinschaftszentren, Sprachkursen und Kulturcafés stärken den sozialen Zusammenhalt und geben den Bewohnern das Gefühl, trotz aller Widrigkeiten nicht alleine zu sein. Viele Flüchtlinge investieren enorme Energie darin, sich weiterzubilden, neue Sprachkenntnisse zu erwerben oder Geschäftsmodelle zu entwickeln, die ihnen eine unabhängige Zukunft ermöglichen sollen. Ibrahim Edris zum Beispiel träumt von einer besseren Zukunft außerhalb Jordaniens, aber sein Wirken in Amman zeigt, wie wichtig es ist, hier und jetzt Räume zu schaffen, in denen Identität und Würde geachtet werden.Die Situation der schwarzen Flüchtlinge in Jordanien ist ein Spiegelbild globaler Ungleichheiten und Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik. Sie zeigt, wie existentielle Notlagen durch soziale Vorurteile und rechtliche Unsicherheiten verschärft werden können.
Doch sie offenbart auch die Widerstandskraft und das Streben nach Selbstbestimmung einer Gemeinschaft, die sich trotz allem nicht zum Schweigen bringen lässt. Es ist dringend notwendig, dass internationale Akteure, die jordanische Regierung und die Gesellschaft als Ganzes diese Situation ernst nehmen, um Diskriminierung zu bekämpfen, Flüchtlingsschutz zu gewährleisten und langfristige Perspektiven zu schaffen.Nur durch gegenseitiges Verständnis, gerechte Integration und die Einhaltung menschenrechtlicher Standards kann es gelingen, den schwarzen Flüchtlingen in Jordanien eine Zukunft voller Chancen zu ermöglichen – eine Zukunft, in der sie nicht nur überleben, sondern wirklich zuhause sein können.