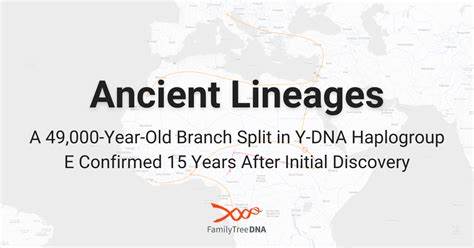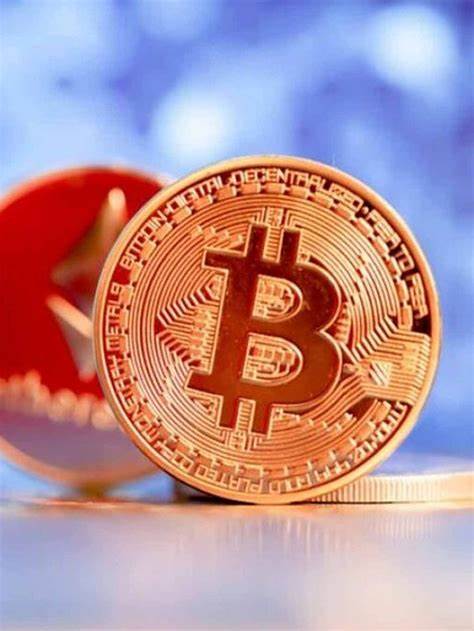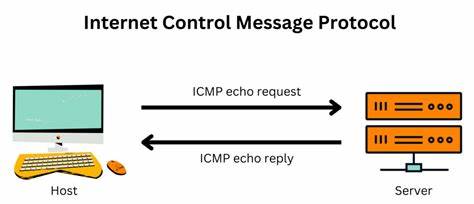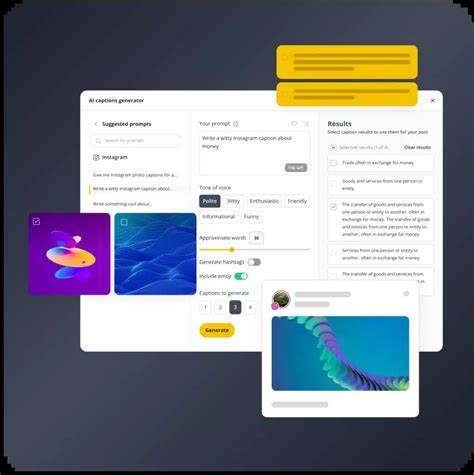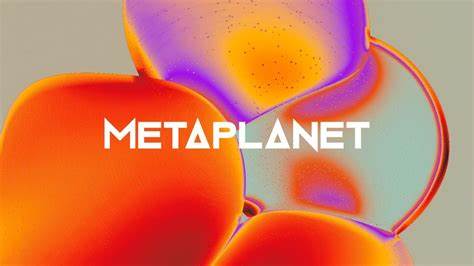Die Sahara ist heute die größte Trockensteppe der Erde und wird durch ihre extreme Trockenheit und lebensfeindlichen Bedingungen geprägt. Doch vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren, während der sogenannten Afrikanischen Feuchtzeit, war diese Region ein grünes, fruchtbares Savannenland – die sogenannte Grüne Sahara. In dieser Zeit förderten Seen, Flüsse und eine üppige Vegetation die Besiedlung durch Menschen sowie die Verbreitung von Herdentierhaltung.
Forschungen im Bereich der Archäogenetik haben nun erstmals genomische Daten aus zwei weiblichen Individuen geliefert, die vor rund 7.000 Jahren in der Takarkori-Felsunterkunft im zentralen Westlibyen lebten. Diese bahnbrechenden Erkenntnisse eröffnen einen umfassenden Einblick in die tiefe genetische Vergangenheit Nordafrikas und werfen neues Licht auf die Entstehung von Pastoralismus sowie die Wanderungen von Bevölkerungsgruppen in der Region. Die Analyse dieser antiken Genome zeigt, dass die Mehrheit ihrer genetischen Herkunft von einer bislang unbekannten, autochthonen nordafrikanischen Linie stammt. Diese Linie ist evolutionär längst getrennt von den Subsaharischen Populationen und spaltete sich ungefähr zur gleichen Zeit wie die heutigen modernen Menschen außerhalb Afrikas ab, blieb aber über lange Zeiten isoliert.
Eine enge genetische Verwandtschaft wird zu 15.000 Jahre alten Jäger-Sammler-Gruppen in der Nähe von Taforalt in Marokko festgestellt, die mit der Iberomaurusischen Kultur assoziiert sind und der Afrikanischen Feuchtzeit sogar vorausgingen. Erstaunlicherweise zeigen die untersuchten Individuen der Grünen Sahara nur sehr geringe genetische Einflüsse aus dem Nahen Osten und ebenso wenig aus Subsahara-Afrika, was auf eine begrenzte Vermischung über die Sahara während der Feuchtzeit deutet. Die Grüne Sahara, heute eine scheinbar lebensfeindliche Wüstenregion, präsentierte sich im frühen und mittleren Holozän als vielfältige und fruchtbare Landschaft mit Savannen, ausgedehnten Wasserflächen und einer großen Bandbreite an Flora und Fauna. Archäologische Funde wie Werkzeuge, Kunstgegenstände sowie Skelettüberreste zeugen von kontinuierlicher menschlicher Präsenz und sozialen Organisationen, die sich zunehmend an herding-orientierte Lebensweisen anpassten.
Die Takarkori-Felsunterkunft in der Tadrart Acacus-Region Libyens gilt als eines der zentralen Ausgrabungsgebiete, da hier gut erhaltene menschliche Überreste gefunden wurden, die Einblicke in die biologischen und kulturellen Entwicklungen der Menschen geben, die in der Grünen Sahara lebten. Mit der Entwicklung und Anwendung hochauflösender DNA-Sequenzierungsmethoden konnten aus den knappen und selten erhaltenen Proben trotz widriger Erhaltungsbedingungen bislang unerreichte genetische Daten gewonnen werden. Die Genomanalyse der beiden Frauen aus Takarkori offenbarte nicht nur die tief afrikanische Urbevölkerungslinie, sondern auch Hinweise auf beeindruckende genetische Isolation. Die geringe Menge an Neandertaler-DNA in ihrem Erbgut verdeutlicht, dass diese Nordafrikaner nur äußerst wenig genetischen Einfluss von außerhalb Afrikas aufgenommen hatten, was ihnen eine einzigartige Stellung unter den frühen menschlichen Populationen verleiht. Vergleichende Studien mit anderen antiken Populationen zeigen, dass die Taforalt-Gruppen in Marokko, die vor etwa 15.
000 Jahren lebten, ähnliche genetische Hintergründe aufweisen. Diese Tatsache legt nahe, dass eine weitverbreitete, stabile Population mit diesem einzigartigen nordafrikanischen genetischen Profil bereits vor Beginn der Grünen Sahara existierte und sich über einen langen Zeitraum erhalten hat. Interessanterweise gab es während der Afrika-Humiden Periode offenbar kaum vertikale oder horizontale genetische Vermischungen über die Sahara hinweg, was im Gegensatz zu den bislang oft angenommenen Wanderbewegungen und Genfluss zwischen Subsahara-Afrika und Nordafrika steht. Die niedrige genetische Durchmischung wird auch durch die Analyse von mitochondrialer DNA (mtDNA) gestützt. Die mtDNA-Linien der Takarkori-Frauen gehören zu einer sehr basalen Haplogruppe N, die weit vor der Diversifikation heute bekannter Linien entstand und eine der ältesten genetischen Spuren außerhalb Sub-Sahara-Afrikas darstellt.
Diese Vererbungslinie steht zeitlich in Zusammenhang mit anderen antiken afrikanischen Populationen und hebt die enge Verwandtschaft des grünen Saharabevölkerungsstamms mit frühen angewandten Kulturentwicklungen hervor. Ein weiterer faszinierender Befund betrifft die Verbreitung der Viehzucht in Nordafrika. Archäologisch wird diskutiert, ob pastoralistische Wirtschaftsweisen durch Migration von Bevölkerungsgruppen aus dem Nahen Osten, etwa aus dem Levante-Gebiet, oder primär durch kulturellen Austausch und Diffusion eingeführt wurden. Die genetischen Daten der Takarkori-Pastoralisten sprechen stark für Letzteres. Die nur marginale Levantinische Genkomponente in ihrem Erbgut zeigt, dass die Viehzuchttechnik in erster Linie mithilfe von Wissensvermittlung und technologischem Transfer, ohne umfangreiche Bevölkerungsausbreitung, in die Sahara gelangte.
Dies stellt eine wichtige Nuance in der globalen Diskussion über den Neolithischen Übergang dar und betont die Komplexität menschlicher Kulturwandelprozesse. Die Erkenntnisse aus der Grünen Sahara beeinflussen auch das Verständnis über Verbreitungswege und Interaktionen heutiger afrikanischer Bevölkerungsgruppen. So weisen genetische Vergleiche mit heutigen Sahel-Gruppen wie den Fulani darauf hin, dass eine Takarkori-ähnliche Abstammung noch heute in geringer Form präsent ist. Das stammt vermutlich von einer südwärtigen Expansion pastoralistischer Bevölkerungsteile aus der Sahara in den Sahel während und nach der Zeit der afrikanischen Feuchtzeit. Somatische Merkmale sowie kulturelle Praktiken bei heutigen Populationen spiegeln diese komplexen Migrations- und Anpassungsprozesse wider.
Durch die Identifizierung einer bislang unbekannten nordafrikanischen Urbevölkerungslinie verändert sich das Bild von Afrikas genetischer Geschichte. Die Sahara, oft als unüberwindbare Barriere betrachtet, hat offenbar trotz phasenweiser Begrünung über viele Jahrtausende hinweg eine genetische Trennung zwischen Subsahara-Afrika und Nordafrika aufrechterhalten. Ökologische Fragmente, klimatische Veränderungen und kulturelle Spezifizierungen dürften zu dieser genetischen Isolation beigetragen haben. Diese Forschungen eröffnen zudem vielfältige Perspektiven für zukünftige Studien. Mit fortschreitender Technologie im Bereich der Paleogenomik und der besseren Probengewinnung durch schonende archäologische Methoden können weitere genetische Daten aus bislang unzugänglichen geografischen Regionen gewonnen werden.
Die Aufklärung solcher tiefer liegenden Populationstrukturen wird nicht nur unser Verständnis von Migration, Kultur und Evolution des Menschen bereichern, sondern auch helfen, die Entstehung heutiger genetischer Diversität präziser nachzuvollziehen. Nicht zuletzt liefern diese Studien auch wertvolle Anhaltspunkte für interdisziplinäre Forschungen, die Archäologie, Klimatologie, Anthropologie und Genetik verbinden. Die Grüne Sahara als Übergangsregion zwischen Afrika und Eurasien stellt ein ideales Modell dar, um dynamische Wechselwirkungen zwischen Umwelt und menschlicher Besiedlung zu untersuchen und die vielschichtige Menschheitsgeschichte besser zu verstehen. Insgesamt verdeutlichen die neuen Analysen antiker DNA aus der Grünen Sahara die Bedeutung Nordafrikas als eines der wichtigsten genetischen und kulturellen Genesezentren. Sie zeigen auf, wie stabil und einzigartig die Menschen in diesem Gebiet während der letzten 15.
000 Jahre agierten, wie kulturelle Innovationen auf komplexe Weise verbreitet wurden und wie große ökologische Veränderungen die Evolution von Bevölkerungen beeinflussten. Darüber hinaus unterstreichen sie die Notwendigkeit, Afrikas Rolle in der globalen Geschichte der Menschheit neu zu evaluieren und mit präzisen wissenschaftlichen Methoden weiter zu erforschen.