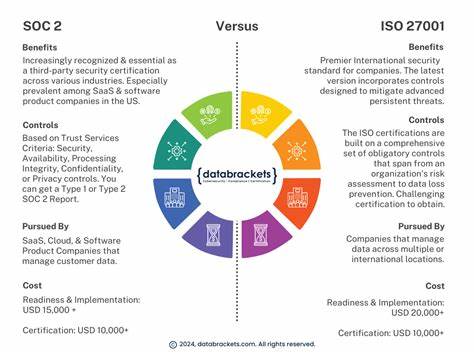Die politischen Wahlkämpfe der Gegenwart finden zunehmend im digitalen Raum statt. Ein besonders aufsehenerregendes Beispiel stammt aus Rumänien, wo die Präsidentschaftswahl 2024 von der massiven TikTok-Kampagne des Kandidaten Călin Georgescu geprägt wurde. Die Kampagne zeigte auf eindrucksvolle Weise, wie soziale Medien systematisch eingesetzt werden können, um das öffentliche Meinungsbild zu beeinflussen – mit allen damit verbundenen demokratischen Herausforderungen. Der Fall bietet wichtige Einblicke in die moderne Art politischer Beeinflussung und die Schwierigkeiten beim Umgang mit digitalen Wahlmanipulationen. Der Hintergrund der Kampagne ist komplex.
Rumänien hatte im Herbst 2024 ursprünglich eine Präsidentschaftswahl abgehalten, deren Ergebnisse später vom Verfassungsgericht annulliert wurden. Dabei spielten Berichte lokaler Geheimdienste eine entscheidende Rolle, die eine groß angelegte Manipulation der Wähler über soziale Medien feststellten. Insbesondere wirkte sich ein Netzwerk aus Fake-TikTok-Konten, koordinierte Echtnutzer auf Plattformen wie Telegram und Discord sowie bezahlte Influencer negativ auf die Chancengleichheit der Kandidaten aus. Die Kampagne wurde finanziell maßgeblich von Bogdan Peșchir unterstützt, der daraufhin strafrechtlich verfolgt wurde. Der Startpunkt der Kampagne lag in der Schaffung einer Armee von Bots und gefälschten TikTok-Accounts.
Mehr als 20.000 solcher Konten wurden nach Ermittlungen der rumänischen Staatsanwaltschaft zwischen 2022 und 2023 angelegt. Diese Konten sorgten für über zwei Millionen kommentierende Beiträge zugunsten Georgescus. Auffällig war, dass die IP-Adressen für die Verwaltung dieser Konten im Ausland, konkret in der Türkei, lokalisiert wurden. Durch die Nutzung eines russischen E-Mail-Dienstes konnten automatisiert zahlreiche Konten erstellt werden, die sich durch ähnliche Namensmuster auszeichneten.
Eine zweite Welle von 25.000 zusätzlichen Konten wurde nur zwei Wochen vor der Wahl aktiviert und steigerte die Sichtbarkeit des Kandidaten erheblich. Untermauert wurde der Einsatz der Fake-Accounts durch die Nutzung einer Plattform namens Social Freak, die den massenhaften Einkauf von Likes und Followern ermöglichte. Für wenig Geld ließen sich innerhalb kürzester Zeit Tausende von Interaktionen einkaufen, was die organische Reichweite irreführend erhöhte. TikTok selbst bestätigte später das Entfernen solcher inauthentischer Konten und Interaktionen in Rumänien – über 60 Millionen Fake-Likes und Millionen von Followern wurden von der Plattform gelöscht.
Diese Aktion zeigt die Herausforderungen, denen soziale Netzwerke gegenüberstehen, wenn es darum geht, Manipulationen durch automatisierte und koordinierte Accounts zu verhindern. Neben den Bots war die Kampagne auch geprägt von einer realen Aktivistenbasis, die via Telegram eng vernetzt war. Der Telegram-Kanal „PROPAGATOR Implică-te și tu, Renașterea României“ wurde zum Dreh- und Angelpunkt für die Koordination der Kampagne. Dieser Kanal diente nicht nur als Sammelstelle für Medieninhalte, sondern gab konkrete Anweisungen zur Umgehung von Algorithmen und dem Einsatz von Softwaretools zur Unterstützung der Kampagne. Regional organisierten sich Unterstützer zudem in Gruppen namens „Hrană – Apă – Energie“, die als lokale Koordinationszentren fungierten.
Die Aktivisten auf Telegram diskutierten dabei auch über mögliche finanzielle Anreize, wenngleich es widersprüchliche Aussagen zu tatsächlichen Zahlungen gab. Während einige Mitglieder angaben, dass kein Geld fließe und alle Ehrenamtler seien, legten Indizien nahe, dass zumindest teilweise finanzielle Zuwendungen über sogenannte TikTok-Geschenke oder Direktzahlungen erfolgten. Dies führte zu Ermittlungen gegen den vermeintlichen Hauptfinancier der Kampagne, Bogdan Peșchir. Über die TikTok-Geschenke konnten Zahlungen anonym und schwer nachvollziehbar an Influencer geleistet werden. Das System der TikTok-Geschenke funktioniert dabei so, dass Nutzer Münzen mit echtem Geld kaufen und diese in Live-Streams als virtuelle Geschenke an Streamer senden können.
Die Streamer wiederum können diese Geschenke in eine Art virtuelle Währung namens „Diamanten“ umwandeln, die in echtes Geld konvertiert wird. Allerdings erhalten die Streamer nur einen Teil des ursprünglich bezahlten Betrags, während TikTok die Differenz behält. Vorteilhaft für die Kampagne war, dass solche Zuwendungen nicht als Werbeeinnahmen im klassischen Sinne gelten, wodurch eine offizielle Deklarierung vermieden wurde. Neben der Zahlung von Influencern, die in ihren Live-Streams oder Posts für Georgescu warben, wurde auch nachgewiesen, dass Stimmen gezielt gekauft wurden. Die Ermittler stützen ihre Anschuldigungen auf die Analyse von Chatverläufen und Zahlungsdaten, die eine direkte Einflussnahme auf das Wahlverhalten einzelner Personen durch Geldzahlungen belegen.
Ein weiterer bemerkenswerter Bestandteil der Kampagne war der Einsatz von sogenannten Mikro-Influencern, die über Plattformen wie FameUp für die Verbreitung von Wahlkampfmaterialien engagiert wurden. Mikro-Influencer haben vergleichsweise kleinere, aber eng verbundene Zielgruppen und gelten als authentisch, was sie für politische Kampagnen interessant macht. In Georgescus Fall kam es zu einer kuriosen Wendung, bei der ursprünglich für einen anderen Kandidaten bestimmte Hashtags auf den Kanälen der Mikro-Influencer heimlich geändert wurden, um stattdessen den Pro-Georgescu-Content zu verbreiten. Dies führte zu einer strafrechtlichen Beschwerde der betroffenen PR-Agentur. Ergänzt wurde die Kampagne durch die Beteiligung einer weiteren Agentur aus Südafrika namens FA Agency, die mit bekannten rumänischen Influencern Kontakt aufnahm.
Diese Agentur bot beispielsweise Influencern Honorare für die Verbreitung eines Videos, das Georgescu unterstützte. Interessanterweise stellte sich heraus, dass die FA Agency möglicherweise eine Tarnfirma eines polnischen Marketingnetzwerks war, das Verbindungen in den Online-Gambling-Bereich aufweist. Dies zeigt die international verzweigten und undurchsichtigen Strukturen hinter modernen digitalen Wahlkampagnen. Der Erfolg der Kampagne spiegelte sich in Georgescus steigendem Bekanntheitsgrad auf TikTok wider. Innerhalb eines Monats stieg seine Follower-Zahl von circa 20.
000 auf über eine halbe Million. Auch die Anzahl von Likes, Kommentaren und geteilten Beiträgen nahm massiv zu. Die damit verbundene Reichweite betrug im November 2024 über hundert Millionen Aufrufe, und die offiziellenhashtags erreichten weit über eine Milliarde Views. Die Präsenz war insbesondere bei jungen Wählern besonders hoch – Studien zeigten, dass ein großer Teil der 18- bis 35-jährigen Rumänen regelmäßig Inhalte über Georgescu auf TikTok sah, selbst wenn sie ihm nicht direkt folgten. Dennoch ist der Einfluss einer Social-Media-Kampagne auf den tatsächlichen Wahlausgang schwer abschätzbar.
Auch wenn Georgescu in Umfragen vor der Wahl deutlich zulegte und schließlich in der ersten Runde mit mehr als 22 Prozent der Stimmen überraschend stark abschnitt, waren andere Faktoren für den Wahlerfolg entscheidend. Dazu zählen Unzufriedenheit mit der politischen Klasse, allgemeines Misstrauen gegenüber den etablierten Institutionen und die Verbreitung von populistischen Botschaften. Die TikTok-Kampagne diente somit als Verstärker eines bereits bestehenden gesellschaftlichen Trends hin zu autoritären und nationalistischen Tendenzen. Als Folge der Wahlkampffinanzierung und der unlauteren Methoden wurde Georgescu vor Gericht gestellt und mehrfach strafrechtlich angeklagt, allerdings nicht direkt wegen der TikTok-Kampagne. Die Unterstützer, allen voran Bogdan Peșchir, stehen hingegen wegen umfangreicher Wählerbestechung unter Anklage.
Georgescu wurde bei der Neuwahl 2025 nicht als Kandidat zugelassen mit Verweis auf sein Verhalten in der vorangegangenen Kampagne. Obwohl die rechtlichen Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, zeigt der Fall die Konsequenzen digitaler Wahlbeeinflussung für die politische Teilhabe in demokratischen Staaten. Eine weitere Brisanz gewinnt die Thematik durch Spekulationen über eine mögliche ausländische Einflussnahme, insbesondere durch russische Akteure. Offizielle Beweise für eine direkte Beteiligung Russlands an der TikTok-Kampagne liegen bislang jedoch nicht vor. Es gibt zwar Hinweise auf Cyberangriffe aus Russland auf Wahlinfrastrukturen Rumäniens, diese stehen aber nicht im direkten Zusammenhang mit der Social-Media-Manipulation.
Der Fall Georgescu illustriert eindrücklich die Herausforderungen demokratischer Wahlprozesse in einer zunehmend digitalisierten Welt. Die Möglichkeiten, soziale Medien für politische Zwecke zu instrumentalisieren, sind enorm, und die Transparenz sowie Nachvollziehbarkeit der Aktionen oft eingeschränkt. Die Kombination aus inauthentischen Accounts, originären Kampagneninhalten, Influencer-Marketing und verdeckten Finanztransaktionen zeigt, wie komplex moderne digitale Wahlkampfstrategien geworden sind. Für Beobachter und Politiker bedeutet dies, dass neue Wege notwendig sind, um Wahlintegrität zu gewährleisten. Plattformen wie TikTok stehen unter wachsendem Druck, Manipulationen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Gleichzeitig ist der Aufklärung von Verstößen durch Strafverfolgung und zivilgesellschaftliche Initiativen entscheidende Bedeutung beizumessen. Nicht zuletzt müssen auch die gesellschaftlichen Ursachen von Politikverdrossenheit und populistischem Denken angegangen werden, um die Verwundbarkeit von Demokratien im digitalen Zeitalter zu reduzieren. Zusammenfassend verdeutlicht die TikTok-Kampagne von Călin Georgescu die Kraft und Ambivalenz sozialer Medien in Politik und Gesellschaft. Die Kampagne führte den jungen Menschen in Rumänien massenhaft Inhalte vor, die ihre Wahrnehmung und ihr Wahlverhalten beeinflussten – zum Teil durch legitime, zum Teil aber durch fragwürdige Methoden. Der intransparenten und teilweise illegalen Finanzierung zum Trotz war die Bewegung Ausdruck eines weit verbreiteten Protests und einer politischen Neuorientierung.
Die kommende Herausforderung wird darin bestehen, solche Entwicklungen transparent und demokratisch kontrollierbar zu machen, ohne die Innovationskraft und Kommunikationsvielfalt digitaler Plattformen einzuschränken.