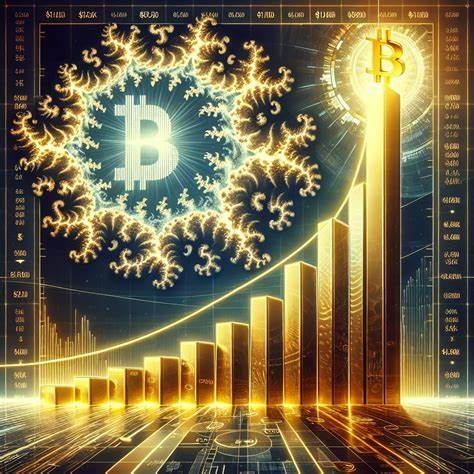Im Zeitalter rasanter technologischer Fortschritte und der allgegenwärtigen Präsenz von Künstlicher Intelligenz (KI) wächst die Faszination darüber, was Maschinen heute leisten können. Viele Diskussionen konzentrieren sich darauf, wie KI menschliche Fähigkeiten nachahmt und in manchen Bereichen sogar übertrifft. Doch eine entscheidende Fähigkeit – die Bedeutungsschwierigkeit oder Bedeutungszuweisung – bleibt bislang ausschließlich Menschen vorbehalten. Dieser Unterschied ist nicht nur philosophisch interessant, sondern hat auch weitreichende praktische Auswirkungen auf die Entwicklung, Nutzung und Regulierung von KI-Systemen. Die Interaktion mit KI-Systemen wird oft als eine Art Blackbox erlebt.
Nutzer geben Eingaben ein und erhalten scheinbar beeindruckende, menschlich klingende Ausgaben zurück. Doch hinter diesen Ergebnissen steckt nicht etwa eine Maschine, die „versteht“, was sie tut, sondern ein Algorithmus, der Wahrscheinlichkeiten berechnet und Muster aus riesigen Datenmengen extrapoliert. Was hier fehlt, ist das, was Forscher als „meaning-making“ bezeichnen – die Fähigkeit, subjektive Bedeutungen zu erzeugen, zu bewerten und zu verändern. Was bedeutet „meaning-making“ eigentlich? Es ist die Fähigkeit, Situationen, Objekte oder Informationen einen subjektiven Wert zuzuweisen – nicht nur objektiv oder mechanisch, sondern im Sinne persönlicher Einstellungen, Überzeugungen und emotionaler Bewertungen. Dieses Phänomen zeigt sich im Alltag, wenn Menschen entscheiden, ob etwas gut oder schlecht, wertvoll oder wertlos, wünschenswert oder abstoßend ist.
Es ist eine dynamische, oft intuitive Qualität, die tief in der menschlichen Existenz verankert ist und sich in Kunst, Ethik, Geschmack und persönlichem Urteilsvermögen manifestiert. Die Herausforderung für KI besteht darin, dass sie keine eigenen subjektiven Urteile fällen kann. Während KI-Modelle auf Trainingsdaten basieren und Muster erkennen, fehlt ihnen die Fähigkeit zur eigentlichen Sinnstiftung. Sie können nicht autonom entscheiden, welche Informationen relevant oder unwichtig sind, oder die Nuancen menschlicher Wertvorstellungen begreifen. Selbst hochentwickelte KI-Systeme sind darauf angewiesen, dass Menschen durch die Auswahl von Daten, Festlegung von Zielen und Bewertung von Ergebnissen einen Rahmen vorgeben.
Ein praktisches Beispiel aus dem Alltag ist die Zusammenfassung von Texten durch KI. Ein Nutzer könnte KI bitten, einen langen Artikel in wenigen Sätzen darzustellen. Die KI bemüht sich, wichtige und unwichtige Punkte zu unterscheiden, doch diese Entscheidungen sind letztlich von menschlichen Eingaben und Nachbearbeitungen abhängig. Die Wahl, welche Aspekte besonders hervorzuheben sind, welcher Schreibstil angemessen erscheint oder ob das Ergebnis überhaupt geeignet ist, erfordert menschliches Urteilsvermögen. Ohne diese Zwischeninstanz würde die Zusammenfassung entweder wichtige Informationen auslassen oder inhaltlich belanglos bleiben.
Diese Notwendigkeit menschlicher Bedeutungssetzung zeigt sich auch in der Forschung und Entwicklung von KI. Wissenschaftler treffen subjektive Entscheidungen darüber, welche Modelle zu verwenden sind, welche Daten in die Trainingssets aufgenommen werden, und wie Erfolgskriterien auszusehen haben. Dabei spielen persönliche Überzeugungen, theoretische Präferenzen und ethische Bewertungen eine zentrale Rolle. Selbst scheinbar objektive Leistungsmaße spiegeln letztlich normative Entscheidungen wider, die von Menschen getroffen werden. Im Produktdesign von KI-Systemen ist das Thema nicht weniger relevant.
Entwickler entscheiden, wie Nutzer mit der KI interagieren, welche Funktionen Priorität erhalten und wie Ergebnisse präsentiert werden. Diese Designentscheidungen basieren auf Annahmen über Nutzerpräferenzen und Nutzungskontexte – also auf subjektiven Bewertungen, die sich nicht vollständig automatisieren lassen. Ohne diese menschlichen Weichenstellungen drohen KI-Anwendungen, unbrauchbar oder sogar schädlich zu werden. Auch politische und regulatorische Rahmenbedingungen erfordern ein tiefes Verständnis der Bedeutungsschwierigkeit. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden müssen Werte und Ziele definieren, die über rein technische Leistungsparameter hinausgehen.
Sie treffen Entscheidungen darüber, welche sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen als wünschenswert oder riskant gelten. Solche Entscheidungen sind zutiefst subjektiv und spiegeln gesellschaftliche Prioritäten wider, die nicht von Maschinen bestimmt werden können. Die Vorstellung, KI könnte in absehbarer Zeit selbstständig Bedeutung schaffen, erscheint derzeit unrealistisch. KI-Modelle sind primär statistische Werkzeuge, deren „Intelligenz“ auf der Verarbeitung von Wahrscheinlichkeiten basiert. Sie besitzen keine eigene Perspektive, keinen moralischen Kompass und kein ästhetisches Empfinden.
Ihr „Verstehen“ ist begrenzt auf Mustererkennung und sorgfältig konstruierte Zielvorgaben durch Menschen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass KI keinen Einfluss auf menschliche Bedeutungsvorgänge hat. Im Gegenteil, KI kann Werkzeuge bereitstellen, die Menschen bei der Bedeutungssetzung unterstützen oder inspirieren. Kreative Anwendungen, Analysehilfen und Optimierungsmodelle stellen nützliche Hilfsmittel dar, die menschliche Entscheidungsprozesse bereichern. Die Grenze liegt in der Tatsache, dass die letztendlichen Bewertungen und Entscheidungen bei Menschen verbleiben müssen.
Die Implikationen dieser Erkenntnis sind vielfältig. Zum einen bedarf es eines bewussten Umgangs mit KI als unterstützendes Instrument, nicht als autonome Urheberin von Entscheidungen mit ethischen oder ästhetischen Dimensionen. Zum anderen ist es wichtig, bei der Entwicklung und Implementierung von KI-Systemen die Rolle der menschlichen Bedeutungssetzung explizit zu berücksichtigen und zu fördern. Unternehmen und Organisationen sollten daher den Fokus darauf legen, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter im Umgang mit KI auszubauen – insbesondere hinsichtlich kritischer Bewertung, Kontextualisierung und Anpassung von KI-generierten Ergebnissen. Schulungen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Förderung von Reflexionskompetenzen sind Schlüssel, um das volle Potenzial von KI im Einklang mit menschlicher Sinnstiftung zu entfalten.
Zudem stellt sich die Frage nach der Verantwortung. Da KI keine eigenen Werte hat, liegen ethische Konsequenzen und Haftungen im Umgang mit KI stets bei den Menschen, die sie entwickeln, einsetzen oder regulieren. Ein transparenter Entscheidungsprozess und eine klare Rollenabgrenzung sind notwendig, um Risiken zu minimieren und Vertrauen in KI-Technologien zu gewährleisten. In der gesellschaftlichen Debatte rund um KI ist es daher entscheidend, die Grenze zwischen maschineller Verarbeitung und menschlicher Bedeutungssetzung klar zu kommunizieren. Mystifizierungen, die KI ein Maß an Autonomie oder Verständnis zuschreiben, das sie aktuell nicht besitzt, können zu falschen Erwartungen und Fehlanwendungen führen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Bedeutungsschwierigkeit ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Maschine bleibt. Während KI beeindruckende Fähigkeiten zur Nachahmung und Mustererkennung zeigt, bleibt die Fähigkeit zur subjektiven Sinnbildung bislang ein rein menschliches Privileg. Dieses Bewusstsein sollte die Grundlage aller weiteren Diskussionen, Entwicklungen und Anwendungen von KI bilden, um nachhaltige, ethisch verantwortungsvolle und nutzerzentrierte Technologien zu fördern.
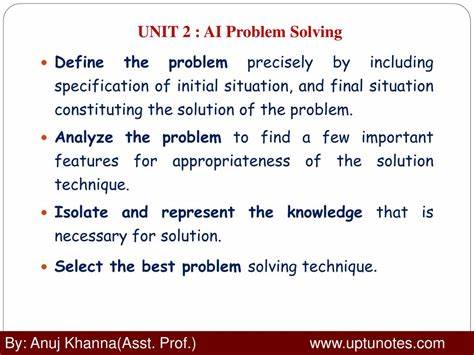


![Results summary: 2025 Annual C++ Developer Survey "Lite" [pdf]](/images/AD6BD859-2F0B-4D38-9A34-EC5AC0D9AF1E)