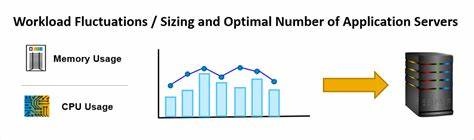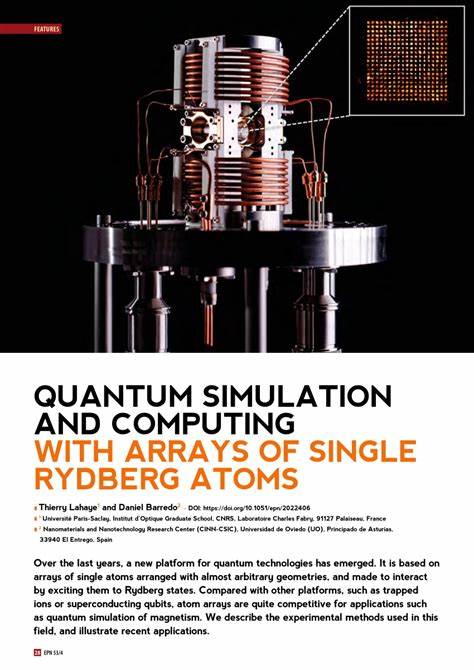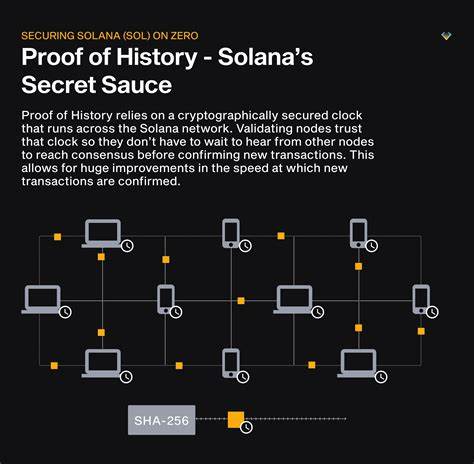Der Lebensmitteleinzelhändler Kroger gehört zu den größten in den Vereinigten Staaten und gilt als Vorreiter, wenn es darum geht, Kundenverhalten aufmerksam zu analysieren und darauf basierende Marketingstrategien zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei das Sammeln von Kundendaten durch das hauseigene Kundenbindungsprogramm, das über 95 Prozent der Kunden nutzen. Diese Daten werden verwendet, um sogenannte Kundenprofile zu erstellen, die aufzeigen sollen, wie einzelne Kund:innen einkaufen, was sie bevorzugen, und welche Angebote für sie besonders attraktiv sein könnten. Doch genau diese Praxis führt zunehmend zu Diskussionen über die Fairness der Preisgestaltung und den Umgang mit persönlichen Informationen. So zeigt der Fall des Kunden Hazem Salem aus Oregon, wie ungenau und fehlerhaft Kroger manche Kundenprofile anlegt, was sich wiederum auf Rabatte und letztlich auf den Preis, den Kunden zahlen, auswirken kann.
Hazem Salem wurde von Kroger in einer akribisch gestalteten Datei als eine Frau mit einem Haushalt von zwei Personen, einem Einkommen von 66.000 US-Dollar und mittelmäßigen Reisewahrscheinlichkeiten eingestuft. Tatsächlich ist Salem jedoch ein Mann, verheiratet, mit einem dreiköpfigen Haushalt und einer weit höheren Einkommensklasse. Zudem widersprechen viele weitere Angaben der Realität, darunter auch die vermeintliche Haustierhaltung und sogar die Kundentreue. Diese Diskrepanz offenbart mehr als nur einen simplen Fehler: Sie zeigt den komplexen und undurchsichtigen Prozess, mit dem Kroger Daten kombiniert, interpretiert und daraus Kaufentscheidungen sowie Rabattangebote ableitet.
So sieht das Unternehmen Rabattangebote vor, die angeblich nicht die Produktpreise direkt verändern, aber dennoch durch die Auswahl und Bewerbung bestimmter Rabatte auf Basis von Käufen und demografischen Daten zu erheblichen Preisunterschieden führen können. Besonders kritisch ist, dass Kunden, die als „weniger loyal“ eingestuft werden – wie Salem aufgrund seiner unregelmäßigen Einkäufe – oft weniger attraktive Angebote erhalten. Kroger behält sich vor, hinter den Kulissen Informationen über seine Kunden mit zahlreichen Drittparteien zu teilen oder zu verkaufen. Diese Praxis erweitert die Reichweite der gesammelten Daten erheblich und betrifft nicht nur Marketingunternehmen, sondern auch zum Teil fragwürdige Akteure wie Tabakunternehmen oder Finanzdienstleister. Die Weitergabe kann zu unerwünschter Werbung und tiefgreifenden Profilierungen führen, die über den ursprünglichen Einkaufsvorgang hinausgehen.
Neben der Tatsache, dass fehlerhafte Daten die Kundenerfahrung negativ beeinflussen, werfen Krogers Aktivitäten wichtige ethische und rechtliche Fragen auf. Die Personalisierung und Segmentierung von Angeboten, die auf mangelhaften oder falschen Daten basieren, kann zur Folge haben, dass einige Verbraucher mehr bezahlen als andere, ohne dass ihnen dies transparent gemacht wird. Dies widerspricht Grundsätzen der Fairness und führt zur Verschärfung sozialer Ungleichheiten. Experten für Verbraucherrecht und Datenschutz warnen davor, dass die fortschreitende Nutzung von Shopper-Profilen und personalisierten Rabatten die Preislücke zwischen wohlhabenden und einkommensschwächeren Haushalten weiter vergrößert. Werden diese Unterschiede von Unternehmen bewusst genutzt, verschärft sich die finanzielle Belastung für weniger zahlungskräftige Gruppen, was gesellschaftlich bedenklich ist.
Dank neuer Datenschutzgesetze in einigen US-Bundesstaaten erhalten Verbraucher nun teilweise erstmals die Möglichkeit, Einblick in die über sie gespeicherten Daten zu nehmen und fehlerhafte Informationen zu korrigieren. Zudem gibt es Optionen zum Schutz der Daten und zum Widerspruch gegen den Verkauf oder die Weitergabe an Dritte. Diese Rechte sind jedoch noch nicht flächendeckend oder umfassend verfügbar, wodurch viele Verbraucher in einer intransparenten Datenwelt verbleiben. Kroger weist darauf hin, dass die Angebote primär auf vorherigen Einkäufen basieren und dass keine Produktpreise direkt individualisiert werden. Dennoch zeigen die praktischen Auswirkungen, dass Kundenprofile erheblichen Einfluss darauf haben, ob man günstigere Rabatte erhält oder nicht.
Die persönliche Situation, wie Einkommen, Bildung und Präferenzen, wird teils mit Hilfe von Online-Verhaltensdaten ergänzt, was den Grad der Überwachung und Datenfülle enorm steigert. Der Fall Salem illustriert exemplarisch, wie persönliche Daten falsch interpretiert werden können und wie sich dadurch Diskriminierungen im Preisgefüge manifestieren. Die Tatsache, dass sogar grundlegende Informationen wie Geschlecht, Haushaltsgröße und Einkommen falsch sind, stellt die Zuverlässigkeit dieser Profile massiv infrage. Verbraucher sollten sich bewusst sein, dass die Teilnahme an Loyalitätsprogrammen zwar Vorteile wie Rabatte bietet, diese jedoch auch den Preis haben, gründlich überwacht und kategorisiert zu werden. Der Schutz der Privatsphäre spielt hier eine zentrale Rolle.
Wer sich nicht mit der Datenerfassung einverstanden erklärt oder die Kontrolle darüber abgeben möchte, sollte die Opt-out-Möglichkeiten nutzen und genau prüfen, welche Informationen preisgegeben werden. Die Debatte um Krogers Datenpolitik wirft auch ein Schlaglicht auf die zunehmende Kommerzialisierung von Kundendaten im Lebensmitteleinzelhandel. Neben dem klassischen Verkauf von Waren wird der Handel mit Daten als wichtige Einnahmequelle erkannt, die Unternehmensgewinne erheblich steigert – in Kroger's Fall machen diese alternativen Profite bereits über ein Drittel des Nettogewinns aus. Datenschutzexperten und Verbraucherschützer fordern daher strengere Regulierung und mehr Transparenz. Nur mit klaren gesetzlichen Vorgaben, die etwa Fehlerraten in Kundenprofilen begrenzen und das Teilen von Daten kontrollieren, kann sichergestellt werden, dass Konsumenten fair behandelt werden und nicht „unsichtbar“ in einem äußerst komplexen und undurchsichtigen Preissystem benachteiligt werden.
Neben den rechtlichen Aspekten bleiben zudem psychologische und gesellschaftliche Fragen offen: Wie wirkt sich die umfassende Überwachung und Personalisierung von Rabatten auf das Kaufverhalten und Vertrauen der Verbraucher aus? Wie akzeptabel ist es, dass ähnliche Produkte in benachbarten Haushalten unterschiedlich bepreist werden, allein basierend auf einer algorithmischen Einschätzung der Kaufwahrscheinlichkeit? Verbraucher in Deutschland und anderen Ländern, die eigenen Datenschutzvorschriften unterliegen, könnten aus dem Kroger-Fall wichtige Lehren ziehen. Überall wächst die Bedeutung von Daten und künstlicher Intelligenz im Handel. Gleichzeitig steigen Bedenken hinsichtlich Privatsphäre, Fairness und der sozialen Spaltung durch datenbasierte Preismodelle. Transparenz und Kontrolle über gesammelte Daten werden zunehmend unverzichtbar, um informierte Kaufentscheidungen treffen zu können und als Verbraucher nicht benachteiligt zu werden. Zusammenfassend zeigt sich, dass die zunehmende Nutzung von Shopper-Profilen im Einzelhandel weitreichende Folgen hat.
Kroger steht exemplarisch für eine Entwicklung, bei der persönliche Daten genutzt, fehlerhaft interpretiert und unerwünscht geteilt werden. Dies kann dazu führen, dass nicht alle Kunden die gleichen Chancen auf attraktive Preise haben. Datenschutzgesetze bieten erste Schutzmechanismen, doch der Weg zu einem fairen und transparenten Handel auf Basis von Kundendaten ist noch lang. Verbraucher sollten sich ihrer Rechte bewusst sein und prüfen, wie sie ihre Daten schützen können – für eine faire und nachhaltige Zukunft im Lebensmitteleinzelhandel.