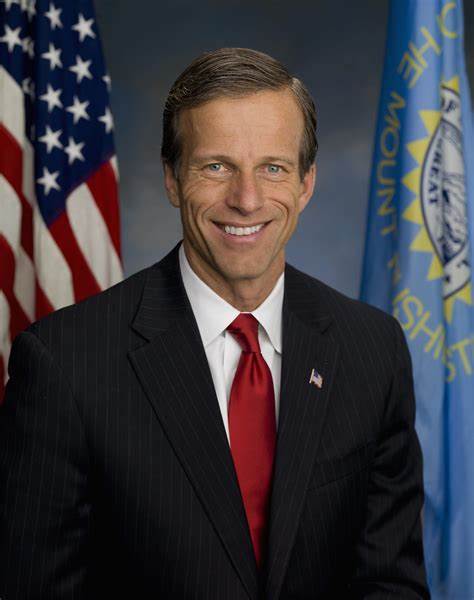Die Klimakrise ist zweifellos eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Während sich das Bewusstsein für den menschengemachten Einfluss auf das Klima stetig erhöht, zeigen aktuelle Forschungen, dass die Mehrheit der Treibhausgasemissionen von einer vergleichsweise kleinen, wohlhabenden Bevölkerungsgruppe verursacht wird. Diese Erkenntnis hebt die Dringlichkeit hervor, soziale Ungleichheiten im Kampf gegen den Klimawandel stärker zu berücksichtigen. Die Auswirkungen von Klimaextremen, wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen, sind mittlerweile spürbar und wirken sich global unterschiedlich aus. Besonders dramatisch ist, dass die Menschen und Regionen, die am wenigsten zur Entstehung des Problems beigetragen haben, am stärksten unter den Folgen leiden.
Diese ungleiche Verantwortlichkeit und Betroffenheit markiert das Herzstück der Debatte um Klimagerechtigkeit. Eine wegweisende Studie, veröffentlicht in Nature Climate Change im Mai 2025, zeigt mit eindrücklichen Zahlen auf, wie besonders die obersten Einkommensgruppen unverhältnismäßig zu den globalen Klimaextremen beitragen. Dabei wird nicht nur CO2, sondern auch Methan und andere nicht-CO2-Treibhausgase berücksichtigt, deren Einfluss auf den Temperaturanstieg teilweise noch stärker ist als bisher angenommen. Die wohlhabendsten zehn Prozent der Erdbevölkerung sind für etwa zwei Drittel des weltweiten Temperaturanstiegs zwischen 1990 und 2020 verantwortlich. Noch konzentrierter wird das Ungleichgewicht, wenn man die obersten ein Prozent betrachtet, deren individuelle Emissionen 20-mal höher liegen als der globale Durchschnitt pro Kopf.
Selbst ein winziger Teil, die obersten 0,1 Prozent, stechen mit dem 77-fachen Beitrag im Vergleich zum Durchschnitt hervor. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll die extrem ungleiche Verteilung von Emissionen basierend auf Einkommen und Vermögen. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Lebensstile und Konsumgewohnheiten in Wohlstandsgesellschaften dem Klima erheblich zusetzen. Private Flugreisen, Luxusyachten, große Immobilien und hoher Energieverbrauch gehören zu den Faktoren, die große CO2-Fußabdrücke hinterlassen. Doch die Studie untermauert zum ersten Mal quantitativ, wie stark diese Unterschiede tatsächlich die globale Erwärmung und die Zunahme von Extremwetterereignissen antreiben.
Darüber hinaus zeigen die Forschenden, dass diese Ungleichheit nicht bei den Emissionen aufhört, sondern sich direkt auf die Häufigkeit und Intensität von Klimaextremen auswirkt. So sind allein die Aktivitäten der reichsten zehn Prozent mit siebenmal mehr an extrem heißen Monaten verantwortlich als es statistisch durch einen Durchschnittsverbraucher erklärbar wäre. Im globalen Mittel ist der Anstieg der sogenannten 1-in-100-Jahre-Hitzewellen - also das Extremereignis, das sich statistisch nur alle hundert Jahre ereignet hätte - schon heute um ein Vielfaches gewachsen. Besonders betroffen sind dabei Regionen wie der Amazonas, Südostasien und Ostafrika, die sich historisch gesehen am wenigsten an der Verursachung des Klimaproblems beteiligt haben, nun aber umso schlimmer von Dürre, Hitze und Wasserknappheit getroffen werden. Das Phänomen, dass wohlhabende Länder oder Bevölkerungsgruppen erhebliche Kosten und Schäden durch Klimaextreme verursachen, welche dann überwiegend in ärmeren Regionen zu spüren sind, wird als Transboundary Impact, also grenzüberschreitende Auswirkungen, bezeichnet.
Ein wichtiger und in der Studie ausführlich behandelte Teilaspekt betrifft die Rolle der wohlhabenden Eliten in großen Volkswirtschaften wie den USA, der Europäischen Union, China und Indien. Hier zeigt sich, dass die „Top-Emittenten“ in ihren jeweiligen Ländern teilweise für deutlich höhere Beiträge an Extremereignissen verantwortlich sind als der Durchschnittsbürger des Landes und oft sogar mehr emittieren als ein ganzer Staat im globalen Mittel. Gerade in den USA führen die Emissionen der reichsten zehn Prozent zu einem drei- bis fünffachen Anstieg von Hitzewellen in oft besonders anfälligen und ohnehin hochbelasteten Regionen. In China spielen die obersten Einkommensgruppen eine ähnliche Rolle, allerdings treten die Auswirkungen dort regional etwas anders hervor. Dabei lohnt es sich hervorzuheben, dass die Zusammensetzung von wohlhabenden Gruppen regional variiert.
Die Reichsten in China und Indien haben in absoluten Zahlen andere und teils geringere Emissionen pro Kopf als in westlichen Ländern, tragen aber dennoch überproportional zu den nationalen Emissionen bei. Neben CO2 wurden in der Analyse besonders Methan (CH4) und Lachgas (N2O) berücksichtigt. Diese klimawirksamen Gase tragen maßgeblich zur Erwärmung bei, vor allem im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum. Die Berücksichtigung dieser Güters ist wichtig, denn Methanemissionen entstehen beispielsweise durch die Viehzucht, Lebensmittelproduktion, Erdgasförderung und bestimmte industrielle Prozesse. Wohlhabende Lebensstile, die besonders viel Fleisch konsumieren oder in Bereichen investieren, die solche Emissionen fördern, verstärken die klimatische Wirkung der oberen Einkommensschichten weiter.
Die Studie fordert daher auch eine stärkere Fokussierung auf kurzfristige Klimagasreduktionen neben den traditionellen CO2-Zielen. Bei der Methodik der Studie kamen sogenannte Emulationsmodelle zum Einsatz. Diese sind in der Lage, komplexe Klimamodelle zu vereinfachen und schnelle Simulationen mit verschiedenen Emissionsszenarien durchzuführen. So konnten die Forschenden hypothetische Szenarien entwickeln, in denen die Emissionen bestimmter Einkommensgruppen vom Jahr 1990 bis 2020 entfernt wurden, um so zu berechnen, wie das Klima ohne ihren Beitrag heute aussehen würde. Diese konterfaktischen Simulationen ermöglichten es, die Wärmesteigerungen und Häufigkeitsveränderungen von Extremereignissen zu quantifizieren.
Die Resultate zeigen, dass ohne die Emissionen der reichsten zehn Prozent die globale Erwärmung seit 1990 nur ein Drittel so hoch ausgefallen wäre. Die Auswirkungen auf extreme Hitzeperioden betreffen jedoch nicht nur langfristige globale Durchschnittstemperaturen sondern vor allem regionale und kurzfristige Ereignisse mit schweren Folgen für Mensch und Natur. Zum Beispiel sind die Monate mit der höchsten Durchschnittstemperatur in bestimmten Regionen heute bis zu 25-mal häufiger extrem heiß als noch vor der Industrialisierung. Diese Verschärfung extremer Hitze hat unmittelbar Folgen für die menschliche Gesundheit, die Landwirtschaft, Wasserversorgung und die Ökosysteme. In der Amazonasregion führt dies zu einer weiteren Schwächung wichtiger Waldund Kohlenstoffspeicher, die wiederum den Klimawandel verstärken.
Die Verteilung der Klimafolgen dankt nicht die Verursacher, sondern trifft meist die Schwächsten. So trägt die Studie dazu bei, die Forderungen nach Klimagerechtigkeit mit wissenschaftlichen Fakten zu untermauern. Finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Anpassung und den sogenannten „Loss and Damage“-Ausgleich werden derzeit als unzureichend und ungerecht wahrgenommen. Dieses Missverhältnis erschwert globale Verhandlungen und den sozialen Zusammenhalt bei der Bekämpfung des Klimawandels. Die Wissenschaft liefert mittlerweile die Evidenzbasis, dass nicht nur Staaten sondern auch einzelne Individuen und deren Wohlstand zentrale Verantwortliche sind und dementsprechend in den politischen Diskurs einbezogen werden müssen.
In sozialen und politischen Debatten gewinnt daher zunehmend die Idee an Bedeutung, gezielte Maßnahmen an wohlhabende Einzelpersonen oder Gruppen zu richten. Potenzielle Instrumente sind etwa eine globale Vermögenssteuer oder CO2-Steuern, die die Finanzierung klimaschonender Maßnahmen ermöglichen und gleichzeitig die Reichen erstmals angemessen an den Kosten des Klimawandels beteiligen. Außerdem wird ein Umbau des Finanzsystems gefordert, um Investitionen von Wohlhabenden in nachhaltige Wirtschaftszweige zu lenken. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass ein Großteil der Emissionen der obersten Einkommensgruppen aus Investitionen und Kapitalbildung stammt. Die Umsteuerung dieser Kapitalströme wird als Schlüsselelement für ein wirksames Klimamanagement angesehen.
Die Studie bringt jedoch auch methodische und ethische Herausforderungen zum Vorschein. Eine zentrale Diskussion betrifft die Frage der Zurechenbarkeit und Verantwortung: Sollten der private Konsum, Investitionen, oder auch Produktionsprozesse gleichermaßen in die Schuldverteilung einbezogen werden? Welche Rolle spielt der soziale Kontext und sind Maßnahmen wie eine globale Vermögensverteilung oder individuelle Emissionsbudgets gerecht? Solche Fragen gehen über die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse hinaus und verlangen interdisziplinäre Ansätze und gesellschaftliche Konsensbildung. Die Studienautorinnen und -autoren betonen, dass ihr Ansatz keine normative Bewertung vornimmt, sondern lediglich den Beitrag verschiedener Einkommensgruppen zu den beobachteten Änderungen im Klima ermittelt. Zusätzlich sind Unsicherheiten bei der genauen Zusammensetzung von Treibhausgasen nach Einkommensgruppen zu beachten. Die verwendeten Emissionen basieren auf Modellen, die zwar weitreichend validiert sind, jedoch gewisse Annahmen treffen müssen.
Insbesondere ist die Sektorenabweichung von Emissionstypen und deren Entwicklung über die Zeit ein offenes Forschungsfeld. Dennoch ist die Richtung und Größenordnung der Ungleichheit so deutlich, dass der dringende Handlungsbedarf nicht infrage steht. Vor allem zeigt die Forschung, dass mit reduzierten Emissionen gerade von Methan eine kurzfristige und wirkungsvolle Abschwächung der Erwärmung und der damit verbundenen Extremereignisse möglich ist. Methanreduktionen könnten unmittelbar den Anstieg von Hitzewellen und Dürren dämpfen, was für die vulnerable Bevölkerung in besonders betroffenen Weltregionen lebenswichtig wäre. Auch wenn die Studie viele wissenschaftliche Erkenntnisse bringt, wirft sie auch Fragen auf, wie der niederschwellige Zugang zu emissionsärmeren Lebensstilen für ärmere Bevölkerungsschichten weltweit ermöglicht werden kann.
Für ein klimaresilientes und nachhaltiges 21. Jahrhundert braucht es Lösungen, die sozialen Ausgleich und ökologische Ziele verbinden. Die Herausforderung besteht darin, wachstumsorientierte Ökonomien umzubauen, ohne Entwicklungsländer zu behindern und globale Ungleichheiten weiter zu verstärken. Zusammenfassend liefert die vorliegende Forschung klare Belege dafür, dass Reichtum und hohe Einkommen eine Schlüsselrolle bei der Verursachung der globalen Erwärmung und der Zunahme von klimaextremen Ereignissen spielen. Die Konzentration von Emissionen auf eine kleine Bevölkerungsgruppe legt nahe, dass konventionelle, gleichverteilte Klimamaßnahmen alleine nicht ausreichen werden, um das Pariser Klimaziel zu erreichen oder die sozialen Kosten des Klimawandels gerechter zu verteilen.