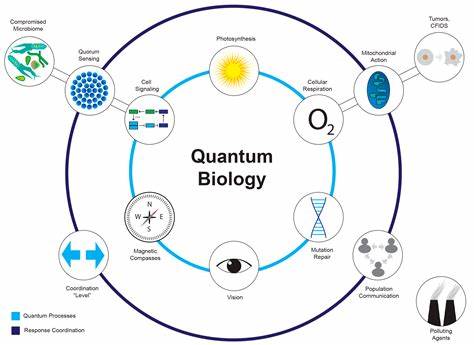Das Vorlesen war lange Zeit ein fester Bestandteil der Eltern-Kind-Beziehung – ein Moment der Nähe, des gemeinsamen Erlebens und des spielerischen Lernens. Doch aktuelle Untersuchungen zeigen, dass immer weniger Eltern das Vorlesen als angenehme Zeit mit ihren Kindern empfinden. Eine Studie von Nielsen und HarperCollins, die im Jahr 2024 durchgeführt wurde, offenbart alarmierende Zahlen: Nur noch etwa 40 Prozent der Eltern mit Kindern im Alter von null bis 13 Jahren geben an, dass ihnen das Vorlesen Spaß macht. Dies ist nicht nur besorgniserregend im Hinblick auf die Lesekompetenz der Kinder, sondern auch auf die emotionale Bindung und die Förderung einer positiven Einstellung zum Lesen. Warum ist das so? Und wie lässt sich dieser Trend umkehren? Diese Fragen sind zentral für Pädagogen, Eltern und alle, die sich für die Zukunft der Lesekultur interessieren.
Zunächst gilt es zu verstehen, warum viele Eltern das Vorlesen als anstrengend oder gar unbeliebt empfinden. Die Studie zeigt, dass viele Eltern das Lesen eher als eine notwendige Fähigkeit betrachten, die ihre Kinder lernen müssen, statt als ein Vergnügen, das sie gemeinsam entdecken könnten. Dieses Verständnis führt dazu, dass Vorlesen vor allem mit Leistungsdruck verbunden wird – ein weiterer Punkt, der den Spaß am gemeinsamen Lesen schmälert. Gerade Eltern aus der Generation Z, die selbst mit digitalen Medien aufgewachsen sind, sehen das Lesen häufig mehr als eine schulische Aufgabe denn als eine Freizeitaktivität. Digitales Entertainment bietet schnelle Reize und unmittelbare Unterhaltung, was den Vergleich mit dem vergleichsweise ruhigeren und kognitiv anspruchsvolleren Lesen für Kinder nicht standhalten kann.
Ein weiterer Faktor ist der zeitliche Druck, unter dem Familien heute stehen. Der Alltag vieler Eltern ist stark durch Arbeit, Haushalt und andere Verpflichtungen geprägt. Ein Drittel der Eltern gab an, dass sie sich mehr Zeit zum Vorlesen wünschen, während fast die Hälfte beklagt, dass Schulaufgaben den Kindern zu viel zeitlichen Spielraum für das freie Lesen lassen. Die Kombination aus Zeitmangel und schulischem Druck sorgt dafür, dass das Vorlesen oft als zusätzliche Belastung empfunden wird statt als entspannendes Ritual. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Eltern das Vorlesen einstellen, sobald ihre Kinder selbst lesen können.
Hier herrscht die falsche Annahme vor, dass Kinder sich dann automatisch für Bücher interessieren und eigenständig lesen werden. Experten widersprechen dieser Vorstellung entschieden, da gerade das fortgesetzte Vorlesen auch bei eigenständigen Lesern den Spaß an Geschichten fördert und den Wortschatz erweitert. Das gemeinsame Lesen ist daher nicht nur in den ersten Lebensjahren wichtig, sondern sollte durchaus auch im späteren Kindesalter gepflegt werden, um die Lesemotivation und die Bindung zu stärken. Die Studie weist auch auf geschlechtsspezifische Unterschiede hin: Mädchen werden im Alter von null bis zwei Jahren deutlich häufiger vorgelesen als Jungen. Dies wirft Fragen zu geschlechterspezifischen Lesegewohnheiten und der Förderung von Lesekompetenzen auf, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, um eine gleichwertige Leseförderung für alle Kinder sicherzustellen.
Trotz dieser Herausforderung gibt es auch positive Erkenntnisse. Eltern, die regelmäßig vorlesen, erleben eine engere Bindung zu ihren Kindern. Fast die Hälfte aller befragten Eltern gab an, dass das gemeinsame Lesen ein Gefühl der Nähe erzeugt. Dies unterstreicht, wie wertvoll das Vorlesen als gemeinschaftliches Erlebnis ist, das weit über die reine Vermittlung von Lesekompetenz hinausgeht. Die Konsequenz daraus liegt auf der Hand: Um die Lesekultur in Familien zu stärken, müssen Vorlesen und Lesen als freudvolle Aktivitäten ins Bewusstsein rücken.
Pädagogische Einrichtungen und Bildungspolitik können hier unterstützend wirken, indem sie die Bedeutung des Lesens für die kindliche Entwicklung stärker hervorheben und Eltern konkrete Hilfestellungen anbieten. Der Fokus sollte dabei nicht nur auf der Vermittlung von Lesefähigkeiten liegen, sondern auf der Förderung einer positiven, emotional positiven Beziehung zum Buch und zu Geschichten. Programme, die Eltern zeigen, wie sie das Vorlesen abwechslungsreich und unterhaltsam gestalten können, sind hier besonders wertvoll. Anregungen wie abwechslungsreiche Stimmführung, das Einbeziehen der Kinder in das Erzählen oder die gemeinsame Auswahl spannender Bücher können Vorlesen zu einem gemeinsamen Familienereignis machen. Auch die Schule spielt eine wichtige Rolle: Lehrkräfte sollten darauf achten, Lesefreude nicht nur als schulische Leistung zu thematisieren, sondern als Freizeit- und Erholungsaktivität zu fördern.
Darüber hinaus ist die Rolle der digitalen Medien nicht nur kritisch zu betrachten. Richtig eingesetzt, können E-Books und interaktive Lesekonzepte Eltern und Kinder zusätzlich ansprechen und als Brücke dienen, die digitales Entertainment und traditionelle Leseförderung miteinander verbindet. Dies erfordert jedoch einen bewussten und reflektierten Umgang mit digitalen Medien und die Auswahl qualitativ hochwertiger Inhalte. Zuletzt ist es wichtig, gesellschaftlich ein Klima zu schaffen, das Lesen als kulturellen und sozialen Wert hochschätzt. Wenn Bücher wieder als Quelle von Freude, Abenteuer und gemeinsamer Erfahrung wahrgenommen werden, entsteht eine natürliche Motivation, die weit über die rein schulische Anforderung hinausgeht.
Lesekultur darf nicht nur auf den Unterricht beschränkt bleiben, sondern muss im alltäglichen Leben stattfinden – zu Hause, in der Familie, zwischen Eltern und Kindern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Freude am Vorlesen bei vielen Eltern derzeit aus verschiedenen Gründen verloren geht. Leistungsdruck, Zeitmangel und der Einfluss digitaler Medien sind zentrale Ursachen. Dennoch gibt es Hoffnung, denn gezielte Förderung, die Vorlesen als gemeinsames, spaßorientiertes Erlebnis positioniert, kann die Lesekultur wiederbeleben. Eltern, Pädagogen und Bildungspolitiker sind gleichermaßen gefordert, aktiv und kreativ auf diese Herausforderungen zu reagieren, um die Liebe zum Lesen bei Kindern früh zu entfachen und nachhaltig zu erhalten.
In einer Zeit, in der Medienvielfalt und Ablenkungen die Aufmerksamkeit der Kinder fordern, bleibt der bewusste Umgang mit Literatur ein wesentlicher Schlüssel zu Wissen, Empathie und persönlichem Wachstum – für alle Generationen.