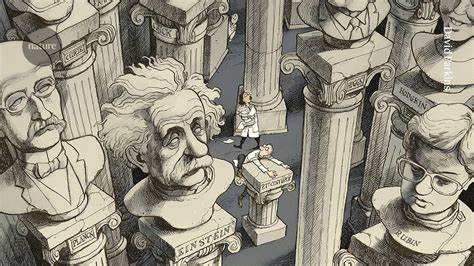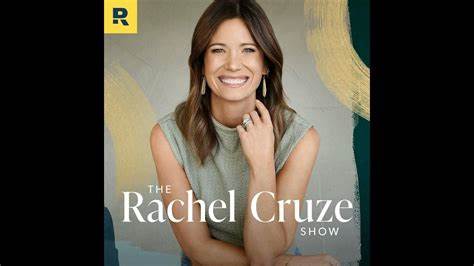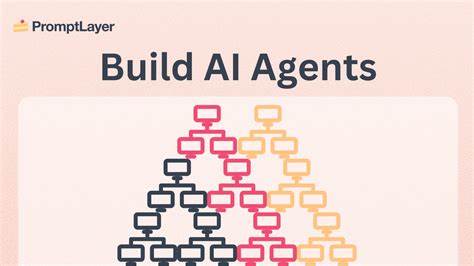Die Suche nach bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen hat eine lange Tradition, die seit Jahrhunderten die Entwicklung der Menschheit vorantreibt. Doch in den letzten Jahren wächst die Debatte unter Forschern und Wissenschaftspolitikern, ob solche revolutionären Durchbrüche heute seltener beziehungsweise schwieriger zu erzielen sind als früher. Während wissenschaftliche Veröffentlichungen und Forschungsaktivitäten global ständig zunehmen, scheint die Zahl der wirklichen Innovationen, welche bestehende Paradigmen grundlegend verändern, nicht im gleichen Maße zu wachsen. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, die weit über bloße Statistik hinausgehen und tief in die Arbeitsweise der Wissenschaft, Finanzierungsstrukturen, gesellschaftliche Erwartungen und technische Herausforderungen hineinreichen. Ein vielbeachteter Ausgangspunkt für diese Diskussion ist die Studie von Russell Funk und seinen Kollegen, die 2023 veröffentlicht wurde.
Sie zeigte anhand eines sogenannten Consolidation-Disruption-Index (CD-Index), dass moderne wissenschaftliche Arbeiten zunehmend weniger disruptive Effekte haben, also seltener bestehende Theorien komplett verdrängen oder außer Kraft setzen. Einfach ausgedrückt: Neuere Forschung macht ältere Arbeiten seltener obsolet, was auf weniger radikale Innovationen hindeutet. Diese Erkenntnis hat eine breite Debatte ausgelöst, inklusive Diskussionen auf politischer Ebene, wie etwa im US-Kongress. Die Messung von Disruption und Innovation in der Wissenschaft ist dabei jedoch selbst ein umstrittenes Thema. Der CD-Index basiert auf Zitationsmustern, wobei disruptive Artikel dadurch charakterisiert sind, dass künftige Arbeiten sie zitieren, ohne deren Vorarbeiten mit anzuerkennen.
Doch Kritiker hinterfragen, ob Zitationen wirklich das Ausmaß an Innovationskraft abbilden können. So wurde zum Beispiel die große Resonanz um das Forschungswerk AlphaFold aus dem Bereich der Proteinfaltung betrachtet – ein technisch revolutionärer Fortschritt, der aber im CD-Index nicht als hochdisruptiv eingestuft wurde. Die Anwendung solcher Indizes bietet also nur begrenzt Einblick in den tatsächlichen Innovationsgehalt. Andere Ansätze versuchen, neben Zitationen auch sprachliche Besonderheiten in Forschungsartikeln und Patenten zu analysieren, um neue, innovative Begriffe oder Konzepte zu identifizieren. Doch auch hier stößt man auf Herausforderungen, da die Sprache und wissenschaftliche Methodik sich im Lauf der Zeit verändert haben und diese Veränderungen schwer standardisierbar sind.
In der Forschungsgemeinschaft herrscht jedoch ein allgemeiner Konsens darüber, dass bahnbrechende Entdeckungen nicht mehr so leicht zu erzielen sind – trotz immer größerer Forschungsteams und steigenden Investitionen. Die US-amerikanische Forschungsausgabe hat sich seit Mitte des letzten Jahrhunderts nahezu verzehnfacht, und die Zahl der aktiven Wissenschaftler ist exponentiell angestiegen. Gleichzeitig wächst der Aufwand signifikant, um vergleichbare Fortschritte zu erzielen, wie Studien etwa in der Halbleitertechnik, der Landwirtschaft oder der medizinischen Forschung belegen. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze dafür. Ein Hauptargument sind strukturelle Rahmenbedingungen der Wissenschaft selbst.
Forschende verbringen heutzutage viel mehr Zeit mit administrativen Tätigkeiten, der Beantragung von Fördergeldern und der Lehre, während die Zeit für sachliche Forschung und vor allem kreatives Denken abnimmt. In manchen Ländern verbringen Professoren weniger als 20 Prozent ihrer Arbeitszeit tatsächlich mit Forschung. Zusätzlich ist die akademische Karriere gefordert, kontinuierlich viele Veröffentlichungen zu produzieren. Das kann dazu führen, dass Ideen zerpflückt und auf viele kleine, eher inkrementelle Artikel aufgeteilt werden, um die Quantität der Veröffentlichungen zu steigern, was die wahrgenommene Disruption weiter verringern könnte. Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Komplexität und Kosten wissenschaftlicher Infrastruktur.
Während im 17. Jahrhundert Wissenschaftler noch in ihren Wohnungen Experimente durchführen konnten, erfordern moderne Projekte häufig teure Großgeräte und internationale Kooperationen. Dies setzt Ressourcen und Flexibilität unter Druck. Das stetig wachsende Wissensfundament schafft ebenfalls Herausforderungen. Forscher müssen immer tiefer in spezialisierte Fachgebiete eintauchen, in denen das Verstehen von Grundlagen bereits Jahre dauern kann.
Die Zunahme des kumulativen Wissens ist dabei mit zunehmender Schwierigkeit verbunden. Interessant ist auch die Beobachtung, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft möglicherweise nicht alle potenziellen Durchbrüche angemessen wahrnimmt, da mit der Flut an Veröffentlichungen auch die Aufmerksamkeit einzelner Forscher begrenzt ist. Algorithmen und soziale Medien können dazu führen, dass die Wissenschaft zeitweise einem „Herdentrieb“ folgt und sich auf etablierte Themen fokussiert, wodurch weniger beachtete, aber potenziell disruptive Arbeiten erst viel später erkannt werden – wenn überhaupt. Wissenschaftspolitisch besteht das Ziel darin, wieder mehr Raum für ambitionierte, risikoreiche Forschung zu schaffen. Studien zeigen, dass stabile und langfristige Förderungen, wie die kontinuierliche Verlängerung von NIH-Forschungsstipendien, mit größeren Innovationspotenzialen einhergehen.
Zudem plädieren Experten für mehr experimentelle Studien zur Erfassung von Innovation und Disruption, die über klassische bibliometrische Indizes hinausgehen. Auch wenn Kritik an bisherigen Messmethoden existiert, gibt die Tendenz der Daten Anlass, über eine grundlegende Veränderung der Forschungskultur und -förderung nachzudenken. Der Innovationsdruck trifft die Wissenschaft im Spannungsfeld zwischen immer größerem Ressourcenaufwand, zunehmender Spezialisierung und den Erwartungen an stetigen wissenschaftlichen Fortschritt. Die Frage, ob bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen wirklich seltener werden, lässt sich daher nicht einfach beantworten. Doch es zeigt sich, dass sich die gesamte Forschungslandschaft verändert hat, was erhebliche Auswirkungen auf Innovationsprozesse hat.
Politische Entscheidungsträger, Förderinstitutionen und Forscher selbst sind gefragt, einen Weg zu finden, der es ermöglicht, transformative Erkenntnisse wieder häufiger zu fördern – und zwar trotz der wachsenden Komplexität und der sich wandelnden Rahmenbedingungen. Insgesamt bleibt die wissenschaftliche Innovationskraft ein zentrales Element für gesellschaftlichen Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung. Umso wichtiger ist es, die Mechanismen, welche die Forschung lenken, kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen, um möglichst vielen bahnbrechenden Entdeckungen den Weg zu ebnen. Nur durch ein ganzheitliches Verständnis der Herausforderungen und Chancen kann die Zukunft der Wissenschaft gesichert werden.