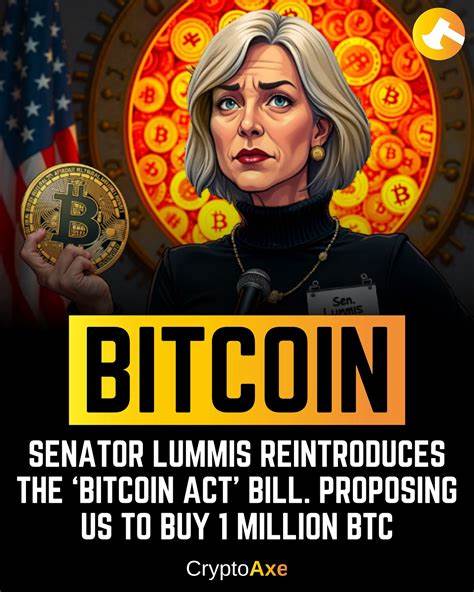Bitcoin gilt seit seiner Einführung 2009 als Vorreiter und Leitwährung im Bereich der Kryptowährungen. Seine begrenzte Gesamtmenge von exakt 21 Millionen Einheiten ist ein zentrales Merkmal, das Bitcoin von traditionellen Fiat-Währungen unterscheidet. Seit Beginn der Auslieferung wurden bereits rund 19,6 Millionen Bitcoin geschürft – das entspricht über 93 % der Gesamtmenge, die jemals existieren wird. Diese Tatsache weckt viele Fragen über die Zukunft von Bitcoin, die Sicherheit des Netzwerks und die möglichen Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage. Das Bitcoin-Protokoll ist so konzipiert, dass die maximale Anzahl an Bitcoin nicht überschritten werden kann.
Diese Obergrenze ist fest im Code verankert und kann nur durch einen fundamentalen, konsensbasierten Eingriff verändert werden – was in der Praxis nahezu unmöglich ist. Der Hauptgrund für diese Begrenzung liegt in Bitcoins Rolle als deflationäres, digitales Asset. Im Gegensatz zu Papiergeld, das theoretisch unbegrenzt gedruckt werden kann, soll Bitcoin durch seine Knappheit langfristig an Wert gewinnen. Ein wichtiger Mechanismus, der die Geschwindigkeit, mit der neue Bitcoin auf den Markt kommen, kontrolliert, sind die sogenannten Halvings. Alle 210.
000 Blöcke, etwa alle vier Jahre, halbiert sich die Belohnung, die Miner für das Lösen komplexer mathematischer Aufgaben und das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain erhalten. So lag die anfängliche Belohnung 2009 bei 50 Bitcoin pro Block. Bis heute sank dieser Wert auf einen Bruchteil und wird weiterhin halbiert werden, bis die letzten Bitcoin etwa im Jahr 2140 geschürft sind. Der hohe Anteil an bereits geschürften Bitcoin ergibt sich aus der großzügigen Belohnung in den Anfangsjahren. Über 87 % der Gesamtmenge waren bereits vor dem letzten Halving 2020 im Umlauf.
Der verbleibende Teil wird durch die fortlaufenden Halbierungen immer langsamer verfügbar. Miner erhalten heute im Vergleich zu den Anfängen deutlich weniger Bitcoin pro gelöstem Block, was den Schürfprozess zunehmend verlangsamt. Dies bedeutet, dass etwa 99 % der Bitcoin nach aktuellen Schätzungen bis 2035 geschürft sein werden, während die letzten, winzigen Bruchteile noch bis ins nächste Jahrhundert hinein freigegeben werden. Diese künstliche Verknappung macht Bitcoin auch aus ökonomischer Sicht besonders interessant. Vergleichbar mit Gold, dessen verfügbare Menge durch geologische und abbaugerechtliche Einschränkungen natürlich begrenzt ist, ist auch die Bitcoin-Menge stark limitiert.
Anders als bei Gold wächst allerdings das Angebot von Bitcoin nicht – und wird es nie mehr – sondern folgt einem klar vorhersehbaren, asymptotischen Abnahmeverlauf, der an das bekannte Zenosche Paradoxon erinnert. Während Gold jährlich in etwa um 1,7 % wächst, nimmt Bitcoins Ausgabe stetig ab und nähert sich damit einer endgültigen Gesamtmenge an. Gleichzeitig führt die Tatsache, dass viele Bitcoin dauerhaft verloren sind, zu einer de facto noch etwas geringeren Verfügbarkeit. Schätzungen renommierter Analysedienste gehen davon aus, dass zwischen 3 und 3,8 Millionen Bitcoin entweder durch vergessene Passwörter, verlorene private Schlüssel oder Hardwareverlust für immer unzugänglich sind. Dazu gehört unter anderem die große Menge an Bitcoin, die sich auf Adressen befindet, welche dem Gründervater Satoshi Nakamoto zugeschrieben werden – diese sind seit Jahren inaktiv.
Das bedeutet, der tatsächlich zirkulierende Bestand an Bitcoin liegt näher bei 16 bis 17 Millionen als bei der theoretischen Gesamtanzahl von 21 Millionen. Da Bitcoin-Transaktionen nicht wieder rückgängig gemacht werden können und zugrundeliegende Schlüssel durch Verlust unbrauchbar sind, vermindert sich das aktive Angebot über die Zeit weiter und verstärkt die Knappheit zusätzlich. Dieser Effekt unterscheidet Bitcoin deutlich von physischen Rohstoffen wie Gold. Obwohl ein Großteil des Edelmetalls bereits gefördert wurde, verbleibt es in verschiedenen Umläufen, etwa in Schmuck, Barren oder als Wertanlage bei Institutionen und Zentralbanken. Gold kann zudem jederzeit wieder eingeschmolzen, umgewandelt und zurückgeführt werden.
Bitcoin hat hingegen keine Möglichkeit, verlorene Einheiten zurückzugewinnen – ein einmal verlorener private Key bedeutet ein unwiderrufliches Verschwinden der entsprechenden Bitcoin. Je stärker sich Bitcoin diesem Status einer „harten“ Knappheit nähert, desto größer werden auch die Konsequenzen für Marktteilnehmer. Die verringerte Verfügbarkeit bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage kann zu einer erhöhten Preisvolatilität führen. Durch den Fokus der verbleibenden Bitcoin auf wenige aktive und gut verwahrte Wallets steigt zudem die Wertkonzentration, was wirtschaftlich zu einer stärkeren Einflussnahme einzelner Akteure führen kann. Zugleich gewinnt die verfügbare, tatsächlich nutzbare Menge an Bitcoin eine besondere Bedeutung.
In Phasen mit eingeschränkter Liquidität an Handelsplätzen oder bei globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten könnten „zirkulierende“ von „unzugänglichen“ Bitcoin stärker getrennt betrachtet werden. Dies könnte einen Preisaufschlag für die liquiden Einheiten rechtfertigen, da diese einen unmittelbaren Zugang und Handlungsfähigkeit ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks, wenn die letzten Bitcoin einmal geschürft sind. Kritiker befürchten, dass mit abnehmenden Block-Belohnungen die Sicherheit des Systems gefährdet sein könnte, da Miner weniger Anreize hätten, die Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu schützen. In der Praxis hat sich das Mining-Ökosystem allerdings als sehr anpassungsfähig erwiesen.
Das Bitcoin-Protokoll enthält eine automatische Schwierigkeitsanpassung, die alle 2.016 Blöcke, etwa alle zwei Wochen, den Schwierigkeitsgrad für das Mining anpasst, um eine konstante Blockzeit von rund zehn Minuten zu gewährleisten. Sinkt die Anzahl aktiver Miner oder wird das Mining unrentabel, verringert sich die Schwierigkeit. Damit bleibt das System im Gleichgewicht, und Miner mit effizienteren Anlagen können weiterhin profitabel arbeiten. Dieses selbstregulierende System wurde bereits mehrfach auf die Probe gestellt.
Nach dem Mining-Verbot in China 2021 sank die weltweite Rechenleistung innerhalb kurzer Zeit um über 50 %. Trotz dieses massiven Rückgangs funktionierte das Netzwerk stabil weiter, und innerhalb weniger Monate erholte sich die Hashrate durch die Verlagerung der Aktivitäten in Regionen mit günstigeren und nachhaltigen Energiequellen. Die Rentabilität des Mining ist nicht nur von den Block-Belohnungen, sondern auch von Transaktionsgebühren abhängig. In jüngster Zeit wurden neue Protokolle entwickelt, die höhere Einnahmen aus Gebühren ermöglichen. So erzielten Bitcoin-Miner beispielsweise am 20.
April 2024 dank des Runes-Protokolls an einem einzigen Tag mehr als 80 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren – ein Rekord, der die Einnahmen aus den Block-Rewards überstieg. Dies zeigt, dass Gebühren in Zukunft eine immer größere Rolle bei der Netzwerksicherung spielen könnten. Ein weiterer Zukunftsfaktor ist die Energiefrage. Während Bitcoin-Mining oft mit hohem Energieverbrauch assoziiert wird, wird zunehmend klar, dass der Stromverbrauch vor allem von der Rentabilität und den Energiekosten getrieben wird. Miner streben zunehmend danach, ihre Anlagen umweltfreundlich und wirtschaftlich zu betreiben, indem sie erneuerbare Energiequellen wie Wasserkraft, Wind oder überschüssigen Ökostrom nutzen.
Aktuelle Studien zeigen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte des Bitcoin-Minings mit erneuerbaren oder zumindest emissionsarmen Energiequellen verbunden ist. Verschärfte regulatorische Rahmenbedingungen in diversen Ländern fördern diesen Trend mit Anreizen für umweltfreundliches Mining und Sanktionen für stark umweltbelastende Verfahren. Das Bitcoin-Netzwerk zeigt damit eine bemerkenswerte Selbstregulierungsfähigkeit, die bereits in der Vergangenheit Überlastungen, politische Eingriffe und technische Herausforderungen meistern konnte. Auf lange Sicht verspricht diese Dynamik eine nachhaltige und sichere Weiterentwicklung, bei der Angebot, Nachfrage, Energieverbrauch und Netzwerksicherheit in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tatsache, dass bereits 93 % aller Bitcoins geschürft sind, das Ende einer Ära markiert, aber gleichzeitig den Beginn einer neuen Phase, die von Knappheit, erhöhter Wertschätzung und ökonomischer Stabilität geprägt sein kann.
Die unveränderliche Gesamtmenge, zusammen mit einer sinkenden verfügbaren Menge durch verlorene Keys, schafft eine historische Anlageklasse mit bislang einzigartigen Eigenschaften. Für Investoren, Miner und das gesamte Kryptowährungs-Ökosystem bedeutet dies, dass strategisches Denken und Anpassungsfähigkeit weiterhin entscheidend sein werden. Während Bitcoin sich immer stärker als digitaler Wertspeicher etabliert, rückt auch die Bedeutung von Liquidität, Sicherheit und nachhaltigem Mining mehr in den Vordergrund. Dieser Wandel ist eine Chance ebenso wie eine Herausforderung für alle Akteure in der Welt der digitalen Währungen.