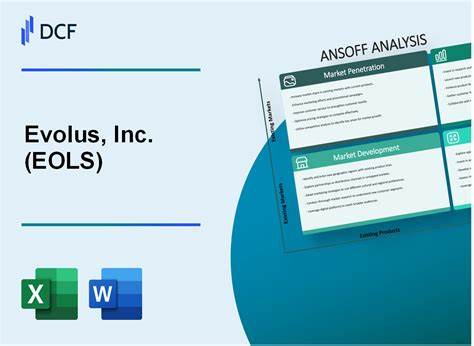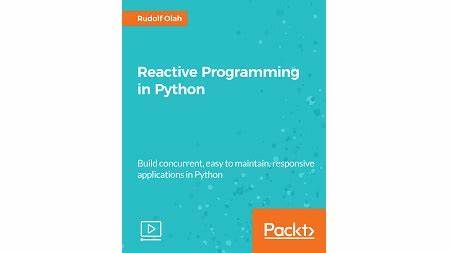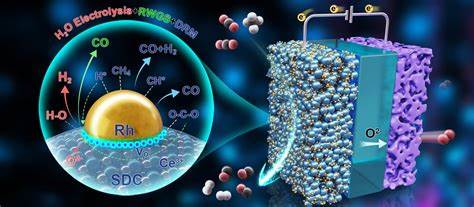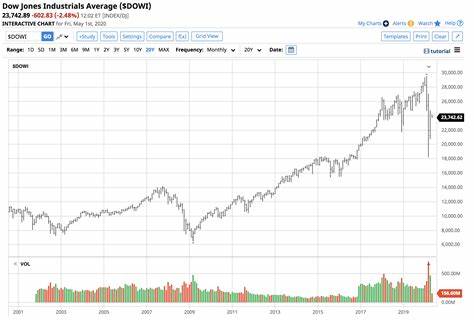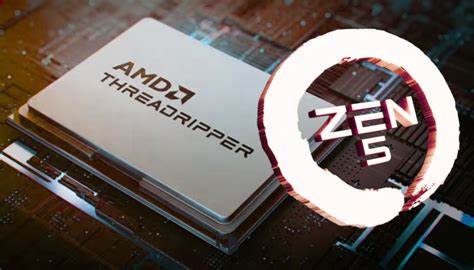Im Jahr 2025 veröffentlichen Ezra Klein und Derek Thompson mit »Abundance« ein Werk, das die liberale Politik in den USA mit einer mutigen Vision für die Zukunft verbindet. Die beiden Autoren sind bereits etablierte Stimmen in der amerikanischen Medienlandschaft: Klein ist bekannt für seine Arbeit bei der New York Times und seine Analysen politischer Polarisierung, während Thompson als Autor und Journalist bei The Atlantic sowie als Podcaster für technologische und ökonomische Fragen geschätzt wird. Ihr gemeinsames Buch wird von vielen als Antwort auf die aktuellen Krisen der Demokratischen Partei verstanden, auch wenn die Veröffentlichung etwas zu spät kam, um direkt in den Wahlkampf 2024 einzugreifen. Die zentrale Botschaft von »Abundance« lautet, dass der Mangel, mit dem viele Lebensbereiche in den USA heute konfrontiert sind, vor allem ein selbstgewähltes Problem darstellt. Die Autoren prangern an, dass politische Blockaden, übermäßige Regulierung und institutionelle Trägheit dazu geführt haben, dass Projekte in den Bereichen Wohnungsbau, Energieversorgung und Verkehr nicht umgesetzt werden oder ins Stocken geraten.
Diese sogenannten »chosen scarcities«, selbstgewählte Knappheiten, behindern den Fortschritt und verhindern die Verwirklichung einer besseren Zukunft, wie man sie sich in den glanzvollen Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums Mitte des 20. Jahrhunderts vorstellen konnte. Die Vision, die Klein und Thompson skizzieren, ähnelt einer Science-Fiction-Erzählung. Sie zeichnen ein Bild des Jahres 2050, in dem erneuerbare Energien allgegenwärtig sind, Wasser preiswert entsalzt wird, Lebensmittel in vertikalen Farmen und im Labor hergestellt werden und fortschrittliche medizinische Innovationen Krankheiten und Alterungsprozesse aufheben. Reisen sind supersonisch schnell, und Künstliche Intelligenz hat die Produktivität so stark erhöht, dass Menschen viel weniger arbeiten müssen.
Diese Zukunft wirkt verlockend, ist aber zugleich gerade wegen ihrer schwebenden Unbestimmtheit auch problematisch. Das Buch bietet weder eine klare Strategie noch ein detailliertes Modell des politischen Wandels, der notwendig wäre, um von der jetzigen, zerrissenen Realität in diese Welt zu gelangen. Die Kontextualisierung dieser Vision im Spiegel vergangener Zukunftsentwürfe macht deutlich, wie sehr das liberale Projekt von Klein und Thompson von einer Nostalgie für die Wohlstands- und Innovationsoptimismus der 1960er Jahre geprägt ist. Die damaligen Weltausstellungen – mit ihren futuristischen Technologien wie Videotelefonen oder Konzepten für Mondstädte – standen symbolisch für eine Zeit, in der der Fortschritt unaufhaltsam schien. Heute jedoch, so der Autor Lee Konstantinou, wirkt diese Zuversicht verloren.
Die neuen Herausforderungen wie politische Polarisierung, wirtschaftliche Stagnation und sozialen Vertrauensverlust werfen Fragen auf, wie es zu diesem scheinbaren Scheitern gekommen ist. Ein wesentlicher Kritikpunkt bleibt, dass Klein und Thompson strukturelle wirtschaftliche Veränderungen wie die Deindustrialisierung weitgehend ausblenden. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, die Automatisierung, der schwindende Einfluss von Gewerkschaften und die zunehmende Ungleichheit sind Faktoren, die die institutionelle Trägheit und den sozialen Zusammenhalt in den USA maßgeblich beeinflussen. Stattdessen konzentriert sich »Abundance« auf politische Fehlentscheidungen und Regulierungslasten als Hauptursachen der aktuellen Probleme. Während dies einen Teil der Realität trifft, bleibt offen, wie ein breiter gesellschaftlicher Wandel möglich ist, wenn die wirtschaftliche Basis sich tiefgreifend transformiert hat und soziale Konflikte zunehmen.
Die Frage, wie die ersehnte Zukunft gebaut werden soll, führt Klein und Thompson zu der Metapher des »Bottleneck Detective«, einem Akteur, der systematisch Engpässe und ineffiziente Prozesse in der staatlichen Verwaltung aufspürt und beseitigt. Dieser Held der Gegenwart soll sozusagen die Rolle übernehmen, die in berühmten Science-Fiction-Romanen von einzelnen mächtigen Akteuren gespielt wird, die mit ihren Ressourcen globale Probleme lösen. Doch anders als die oft antidemokratisch oder elitär konzipierten Figuren in manchen futuristischen Erzählungen soll hier ein kompetenter, zielorientierter Beamter im Dienst einer demokratisch legitimierten Verwaltung stehen. Diese Vorstellung steht jedoch vor einem Dilemma. Wie lässt sich eine solche Kompetenz und Effektivität in eine demokratische Gesellschaft mit ihren verschiedenen Interessen und Machtgefügen integrieren? Es wird diskutiert, ob die Suspendierung demokratischer Prozesse wie im Beispiel des schnellen Wiederaufbaus eines Autobahnabschnitts in Pennsylvania wirklich zukunftsträchtig ist oder vielmehr auf ein Modell staatlicher Ausnahmepolitik verweist, das sich kaum dauerhaft etabliert lassen wird.
Auch die Einbettung der politischen Visionen von Klein und Thompson in einen breiteren Diskurs über Zukunftsentwürfe, die vom linken bis zum rechten Spektrum reichen, eröffnet interessante Überlegungen. Während linke Denker wie Kim Stanley Robinson oder Aaron Bastani eine postkapitalistische, teilweise radikal postarbeitsgesellschaftliche Zukunft favorisieren, betonen Silicon-Valley-Technologen wie Elon Musk oder Marc Andreessen den Einfluss von Unternehmertum, technologischer Innovation und einem Staat, der vor allem nicht im Weg stehen darf. Klein und Thompson stehen mit ihrer Forderung nach einem handlungsfähigen, regulierten Staat irgendwo in der Mitte, teilen jedoch mit beiden Seiten die Hoffnung auf die transformative Kraft von technologischem Fortschritt und produktivem Aufbau. Ihre Vision bleibt dennoch unvollständig, denn sie liefern keinen konkreten Plan, wie die notwendigen Bündnisse und politischen Mehrheiten entstehen sollen, um das staatliche Handeln in diesem Maße zu erneuern. Es fehlt die Vorstellung davon, wie soziales Vertrauen, Solidarität und demokratische Legitimation aufgebaut werden können, die für ein solch ambitioniertes Projekt unverzichtbar wären.
Die Erinnerung an den New Deal und die Mobilisierung im Zweiten Weltkrieg zeigt, dass radikale Transformationen möglich sind, wenn die politischen und sozialen Bedingungen stimmen – doch heutige Populismen, Wirtschaftsstrukturwandel und politische Fragmentierungen stellen ganz andere Herausforderungen. Letztlich ist »Abundance« ein aufrüttelndes Manifest für einen liberalen Neubeginn, dessen Stärke in der inspirierenden Zukunftserzählung und dem Aufruf zum aktiven Wiederaufbau von Versorgungsstrukturen liegt. Gleichzeitig verdeutlicht es die Grenzen gegenwärtiger politischer Vorstellungskraft bei der Bewältigung tiefgreifender wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen. Der Appell, den Staat als handlungsfähigen und kompetenten Akteur zu erneuern, ist notwendig, aber er bedarf einer ergänzenden Vision, wie demokratische Partizipation und gesellschaftliche Koalitionen den Weg ebnen können. Diese Debatte über Zukunft, Fortschritt und Politik bleibt unverzichtbar, denn sie verhandelt nichts weniger als die Frage, welche Gesellschaft wir sein wollen.
Die Bilder von Jetpacks und Weltraumkolonien mögen heute futuristisch anmuten, doch die grundsätzlichen Herausforderungen von ambitioniertem politischem Handeln, Vertrauen und kollektiver Gestaltungskraft sind zeitlos. »Abundance« liefert hier eine wichtige Diskussionsgrundlage, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen eines visionären Liberalismus im 21. Jahrhundert herausarbeitet.