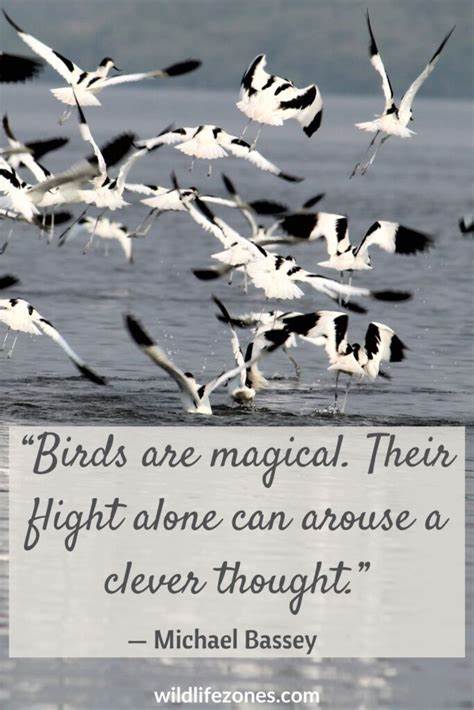In einer Zeit, in der Roboter zunehmend in unser tägliches Leben integriert werden, nimmt die Forschung zu Interaktionen zwischen Tieren und Robotern eine immer bedeutendere Rolle ein. Vor diesem Hintergrund entschied ich mich, meiner Kaninchenfreundin, Topsey, eine Roboterkatze als Spielgefährtin zu besorgen. Die Idee hinter diesem Experiment entsprang einer Mischung aus Neugier und dem Wunsch, die Wirkung von Pflege-Robotern auf Tiere genauer zu beobachten. Was dabei herauskam, war eine überraschende Erkenntnis über die Grenzen und Möglichkeiten solcher Technologien im Bereich tierischer Begleitung und Pflege. Die Roboterkatze, die ich beschaffte, stammt von der Firma Ageless Innovation und wurde ursprünglich entwickelt, um Menschen mit Demenz ein Gefühl der Ruhe und Begleitung zu bieten.
Diese Roboter sind so gestaltet, dass sie eine lebensechte Wahrnehmung besitzen: Sie bewegen sich, schnurren und reagieren auf Berührungen. Auf den Menschen wirken sie dadurch sehr real und einfühlsam. Doch wie reagieren Tiere darauf? Topsey, mein Hauskaninchen, erwies sich als äußerst gleichgültig gegenüber der Roboterkatze. Während ich darauf hoffte, dass das Kaninchen durch diese „Artgenossin“ in Bewegung und Interaktion angeregt wird, blieb die Reaktion überwiegend von Desinteresse geprägt. Dies war zunächst ernüchternd, doch zugleich eröffnete es eine spannende Perspektive, die weit über einfache Spielereien hinausgeht.
Im Kontext von Tier-Roboter-Interaktionen geht es vor allem um das Konzept der „Intelligibilität“ zwischen Roboter und Tier. Für eine erfolgreiche Kommunikation müssen die gezeigten Signale und Bewegungen der Roboter vom Tier verstanden und interpretiert werden. Dies unterscheidet sich stark von der menschlichen Wahrnehmung, die Roboter oft als Annäherung an lebendige Wesen wahrnimmt, während Tiere hierzu meist weniger affin sind. Die Roboterkatze beispielsweise ist so programmiert, dass sie menschliche Erwartungen erfüllt, nicht unbedingt die Bedürfnisse oder das Verhalten eines Kaninchens anspricht. Das Fehlen echter sozialer Signale, wie sie unter Kaninchen üblich sind, könnte einer der Hauptgründe sein, warum Topsey keinerlei Interesse an der Roboterkatze zeigte.
Tiere besitzen sehr spezialisierte Kommunikationsformen, die über komplexe Körpersprache und Feinsinnigkeit verlaufen. Roboter, die vorwiegend für menschliche Nutzer entworfen werden, laufen Gefahr, außerhalb dieses Spektrums wahrgenommen zu werden – wenn überhaupt. Interessanterweise zeigte sich, dass auch andere Haustiere, die ich mit der Roboterkatze bekannt machte, ebenso wenig die Illusion akzeptierten, dass das Gerät ein lebendiges Tier sein könnte. Trotz der Bemühungen, den Kontakt filmisch festzuhalten und über Plattformen wie TikTok einem größeren Publikum vorzustellen, dominierten Momente des Nicht-Interesses. Dies wirft Fragen über den tatsächlichen Nutzen solcher Pflege-Roboter im tierischen Kontext auf.
Aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es dennoch eine wachsende Zahl von Studien zur so genannten Animal–Robot Interaction (ARI), einer Disziplin, die erforscht, wie Tiere mit Robotern kommunizieren und interagieren. Dabei wird deutlich, dass Bewegung, Aussehen und sogar Wärmeemission eine Rolle spielen können, um beispielsweise Vögel, Fische oder Insekten für Forschungen oder im Naturschutz zu leiten. Für Haustiere und vor allem Säugetiere könnte dies eine Herausforderung darstellen – oder eine Chance, wenn die Robotik entsprechend angepasst wird. Ein bedeutsamer Aspekt, der in der Forschung immer wieder zur Sprache kommt, ist die Unterscheidung zwischen dem Verhalten, das Tiere gegenüber Robotern zeigen, und deren tatsächlicher emotionaler Wahrnehmung. Nur weil ein Hund durchaus auf eine Roboterattrappe reagiert oder ein Kaninchen neugierig schaut, heißt das noch lange nicht, dass diese Roboter tatsächlich als Artgenossen oder Gefährten wahrgenommen werden.
Emotionalität und Bewusstsein lassen sich bei Tieren schwer beobachten und noch schwerer interpretieren. Der Gedanke, Robotik im Rahmen von Tierpflege oder Begleitung einzusetzen, bringt zudem eine ethische Dimension mit sich. Die Vorstellung, dass Haustiere in Zukunft von Robotern betreut oder beschäftigt werden, wirft Fragen über Loyalität, emotionale Bindungen und das Wohlbefinden der Tiere auf. Besonders wenn man die Erfahrung mit der Roboterkatze betrachtet, wird klar, dass die Bedürfnisse von Tieren nicht einfach durch technologischen Ersatz befriedigt werden können. Auf der anderen Seite könnten diese Technologien durchaus sinnvoll für bestimmte Forschungsvorhaben sein.
So hat die Robotik bereits in der Verhaltensforschung bei Vögeln oder Fischen Anwendung gefunden, wo Roboter eingesetzt werden, um natürliche soziale Strukturen zu manipulieren oder zu studieren. Anwendungen im Umweltschutz – etwa zum Monitoring gefährdeter Arten oder zum Schutz vor Wilderern – sind vielversprechend. Für Haustiere jedoch steht der direkte emotionale Kontakt zum Menschen meist im Vordergrund. Die Gefahr, diesen durch Roboter zu substituieren, erscheint nicht nur fragwürdig, sondern sogar bedenklich. Gerade die uneingeschränkte Aufmerksamkeit, die ein echtes Tier oder ein geliebtes Haustier erhält, kann durch Maschinen nicht ersetzt werden.
In meinem Experiment mit der Roboterkatze wurde diese Lücke besonders deutlich. Erstaunlich war, dass trotz der zurückhaltenden Reaktion von Topsey und anderen Haustieren der digitale Content auf TikTok eine große emotionale Wirkung auf menschliche Betrachter zeigte. Viele Nutzer reagierten mit positiven Reaktionen, was zeigt, dass die Wahrnehmung von Robotern als „künstliche Gefährten“ in der Gesellschaft durchaus auf Interesse stößt. Damit eröffnet sich ein Spannungsfeld, das soziale und technologische Entwicklungen miteinander verbindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kauf einer Roboterkatze für ein Kaninchen mehr als nur eine kuriose Geschichte ist.