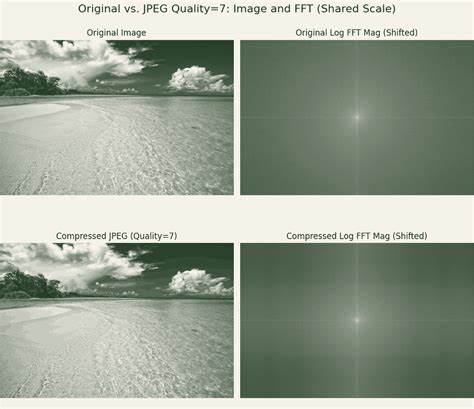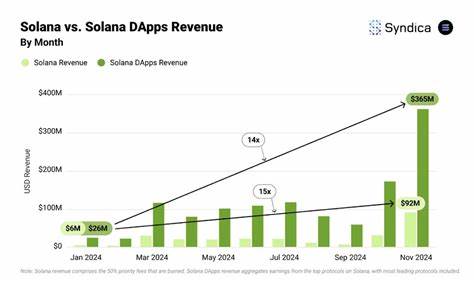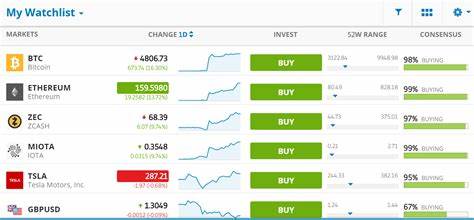Im Jahr 1982 standen die sowjetischen Planer vor einer enormen Herausforderung, die weit über technische und wirtschaftliche Aspekte hinausging. Das ehrgeizige Vorhaben, die natürlichen Flussläufe umzukehren und Wasser von den nördlichen in die südlichen Regionen des Landes umzuleiten, sollte den steppenartigen Gebieten Zentralasiens Erleichterung bringen, die regelmäßig unter Wassermangel litten. Die Idee, die großen arktischen Flüsse in Richtung Süden zu lenken, versprach eine Lösung für vielfältige Probleme – von landwirtschaftlichen Erträgen bis hin zur demografischen Stabilität – barg jedoch zugleich enorme Risiken und brachte kontroverse Debatten in der sowjetischen Gesellschaft und weit darüber hinaus mit sich. Das Kernproblem war geographischer Natur. Die Sowjetunion war durch einen seltenen natürlichen Umstand geprägt, der bedeutende Flüsse hatte, die entgegen der natürlichen Erwartung nicht nach Süden, sondern nach Norden in das Eis des Arktischen Ozeans flossen.
Dieses Ungleichgewicht wirkte sich gravierend auf die wasserarme Zone Zentralasiens aus. Millionen Menschen in den Republiken Usbekistan und Kasachstan litten unter den Folgen ungenügender Bewässerung, was in Verbindung mit hohen Geburtenraten eine angespannte Situation schuf, die mit der Nahrungsmittelversorgung nicht Schritt halten konnte. Bereits im 19. Jahrhundert hatte der czaristische Vermesser Alexander Shrenk die Idee geäußert, den Lauf des Pechora-Flusses zu verändern, damit dessen Wasser in den Volga-Fluss münden sollte, der durch den fruchtbaren Süden Russlands fließt. Unter Stalin wurde das lange als bloße Fantasie abgetan, da die technisch und finanziell herausfordernden Projekte jener Zeit mehr auf den Ausbau von Staudämmen und der Energieerzeugung abzielten als auf großflächige Landschaftsumgestaltungen.
Doch in den 1980er Jahren nahm die sowjetische Führung die Idee wieder auf und plante ein bis dato beispielloses Wasserumleitungsprojekt. Die Realisierung dieses Plans sollte zwei komplexe Systeme umfassen – die europäische Seite westlich der Uralberge und die asiatische Seite in Sibirien. Im Westen war vorgesehen, die Ströme von Onega, Nördlicher Dwina und Pechora umzuleiten, sodass sie nicht mehr in das Nordpolarmeer, sondern in den Volga münden würden. Dies hätte nicht nur die Wasserversorgung Südrusslands verbessert, sondern auch den weitreichenden Nutzen für die Landwirtschaft in den trockenen Zentralasien-Republiken gebracht. Gleichzeitig sollte ein ganzes Netz von Staudämmen, Pumpstationen und Dämmen errichtet werden, um die Flüsse schrittweise künstlich anzuheben und umzuleiten.
Sowjetische Pläne sagten voraus, dass bereits bis Ende der 1980er Jahre die ersten Wassermengen in die neuen Richtungen fließen würden. Im asiatischen Teil umfasste das Projekt den gewaltigen Ob-Fluss und seinen Nebenfluss Irtysch, die ursprünglich durch einen etwa 2.400 Kilometer langen Kanal neu geleitet werden sollten. Die Pläne, den Kanal durch nukleare Sprengungen zu realisieren, stießen sowohl intern als auch international auf massive Kritik. Daher wurden alternative Wege untersucht, sogenannte alte Flußbetten, die dank moderner Satellitenaufnahmen wiederentdeckt wurden, um die Wasserführung anzupassen – ein gewaltiges Vorhaben für die damalige Zeit.
Die Befürworter der Flussumkehrungen betonten vor allem die enormen wirtschaftlichen Vorteile. Mit zusätzlichen Jahrzehnten kann die landwirtschaftliche Produktion um bis zu 30 bis 60 Millionen Tonnen Getreide steigen, was bis zu einem Drittel der damaligen Ernte der Sowjetunion entspricht. Der Ausbau der Bewässerung würde nicht nur die Ernährungssicherheit verbessern, sondern auch die schwindenden Wasserstände wichtiger Binnenmeere wie dem Kaspischen und dem Aralsee positiv beeinflussen. Gleichzeitig entfalten sich die Schattenseiten dieses gigantischen Vorhabens in aller Deutlichkeit. Die großflächige Überflutung von Wäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen im Norden bedeutete nicht nur den Verlust von Heimatregionen für zigtausende Menschen, sondern auch die Störung vielfältiger Ökosysteme.
Historische Siedlungen, sogar Gemeinden mit mittelalterlichen Kirchen, sollten dem Projekt zum Opfer fallen, was zu sozialem Widerstand führte – ein seltener Vorgang in der sonst so reglementierenden sowjetischen Gesellschaft. Ökologische Bedenken waren von herausragender Relevanz. Die heimischen Fischbestände, insbesondere Wanderfische wie Lachs, würden durch die veränderten Wasserläufe massiv gestört. Die Flüsse dienten als wichtige Laichplätze, deren Verlust zudem wirtschaftliche Folgen hatte. Auch die winterlichen Bedingungen der neuen Stauseen sahen Experten kritisch: Dicke Eisschichten könnten den ohnehin kurzen Anbauzyklus weiter verkürzen, indem sie den Frühlingseinbruch verzögern und somit die Vegetationszeit spürbar einschränken.
Dies würde die geplanten landwirtschaftlichen Erträge wiederum negativ beeinflussen. Darüber hinaus warnten Klimatologen eindringlich vor möglichen globalen Klimafolgen. Die Arktis, die auf den Zufluss von Süßwasser angewiesen ist, könne durch den Wasserentzug salziger werden. Ein veränderter Salzgehalt beeinflusst die Meereisbildung, was eine Kaskade von Effekten auslösen kann, die bis zur globalen Erwärmung oder in gewissen Szenarien sogar zur Expansion des Polareises führen könnten. Die Verschiebungen der Meeres- und Luftzirkulation hätten womöglich negative Auswirkungen auf den Niederschlag in genau jenen Regionen, die eigentlich vom Projekt profitieren sollten.
Die Diskussion um das Flussumleitungsvorhaben brachte einige ungewöhnliche Debatten in der Sowjetunion in Gang. Trotz der ansonsten durch Zensur und politische Kontrolle geprägten Atmosphäre erhoben sich Stimmen von Wissenschaftlern, Ökonomen und Bürgern gegen das Projekt. Schon früh kristallisierte sich heraus, dass die sozialen und ökologischen Risiken die erwarteten ökonomischen Vorteile möglicherweise bei weitem übersteigen könnten. Die Kritik fand sogar Eingang in offizielle Medien, wie die renommierte "Literarische Zeitung", was als Ausdruck einer sich wandelnden inneren Dynamik der sowjetischen Gesellschaft galt. Angesichts der immensen Kosten – allein die Anfangsinvestitionen wurden auf rund 40 Milliarden US-Dollar geschätzt – und der unvorhersehbaren Folgen war das Projekt eine immense Herausforderung.
Es zeigte exemplarisch die Spannungsfelder zwischen zentralistisch gelenkter Großplanung, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und menschlichem Wohlstand auf. Rückblickend betrachtet lässt sich festhalten, dass das sowjetische Programm zur Flussumkehrung eines der radikalsten und umstrittensten Umwelt- und Infrastrukturprojekte des 20. Jahrhunderts war. Es steht für den Versuch, durch massive Eingriffe in die Natur unumkehrbare Veränderungen herbeizuführen – mit Chancen auf Verbesserung, aber auch mit Gefahren für Mensch und Umwelt. Die Debatten und Bewertungen über dieses Vorhaben sind deshalb nicht nur für Historiker und Umweltexperten von Bedeutung, sondern liefern wichtige Erkenntnisse für heutige und zukünftige Diskussionen über nachhaltige Wasserwirtschaft, Ressourcennutzung und den Umgang mit natürlichen Ökosystemen in großem Maßstab.
Die Geschichte der Flussumleitung in der Sowjetunion mahnt zur Vorsicht bei der Beurteilung großer technischer Eingriffe und zeigt, wie eng ökologische, soziale und politische Faktoren verflochten sind.