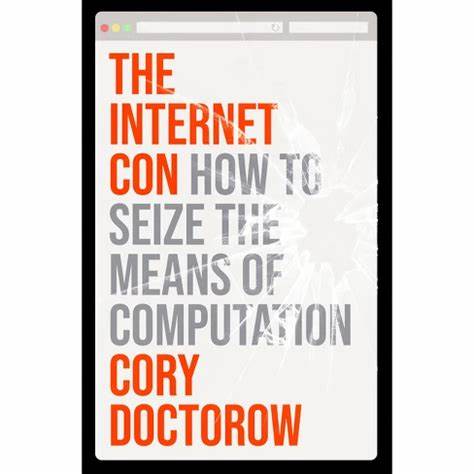Das Internet war einst ein Symbol für Freiheit, Innovation und weltweite Vernetzung. Doch heute ist es weit davon entfernt, ein uneingeschränkt freier und offener Raum zu sein. Cory Doctorow, renommierter digitaler Aktivist, Autor und Berater der Electronic Frontier Foundation, spricht von der „Enshittifikation“—einem Begriff, den er prägte, um den schleichenden Verfall von Technologieplattformen zu beschreiben. In seinem Vortrag auf der PyCon US 2025 in Pittsburgh erläuterte Doctorow anschaulich, wie wir das Internet in den Zustand gebracht haben, in dem es sich heute befindet, und welche zentralen Faktoren diesen Wandel bestimmt haben. Er beschreibt nicht nur die Symptome, sondern legt insbesondere die politischen und wirtschaftlichen Ursachen offen.
Dabei macht er deutlich, dass das aktuelle „Enshitternet“ keinesfalls unvermeidlich war, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen und nachlässiger Regulierung ist. Doctorow beginnt seinen Vortrag mit einem Beispiel aus der realen Arbeitswelt, das stellvertretend für den Zerfall technologischer und gesellschaftlicher Systeme steht: Das Phänomen des „Uber für Pflegekräfte“. Immer mehr Krankenschwestern und Pfleger erhalten Aufträge über eine Handvoll spezialisierter Apps, die sich als flexible Vermittlungsplattformen präsentieren. Diese Unternehmen bilden ein kartellartiges Geflecht, in dem sie den Preis für Arbeit regulieren und die Nutzer systematisch ausbeuten. Ein besonders erschreckender Aspekt ist, dass die App-Anbieter vor der Vergabe eines Einsatzes persönliche Finanzdaten der Pflegekräfte von Datenhändlern einkaufen.
Je höher die Verschuldung und finanzielle Notlage einer Pflegekraft ist, desto niedriger ist das Lohnangebot, mit dem diese gelockt werden soll. Es entsteht ein Teufelskreis, in dem die Verzweiflung zugunsten der Profitmaximierung instrumentalisiert wird. Diese Praxis ist grossartig beispielhaft für den Begriff der Enshittifikation, da nicht nur der Wert für die Nutzer drastisch sinkt, sondern auch die Würde der Betroffenen missachtet wird. Der Begriff Enshittifikation beschreibt laut Doctorow einen dreistufigen Prozess, der das Schicksal vieler großer Internetplattformen verfolgt. Am Anfang steht die Investition in eine hochwertige Nutzererfahrung, um eine dominante Nutzerbasis aufzubauen.
Anwendungen wie Google haben zu Beginn mit wenig Werbung und viel Aufwand eine erstklassige Suchmaschine geschaffen und mit massiven Investments Kunden gewonnen und gebunden. Im zweiten Stadium, wenn Nutzer quasi gefangen sind, verschieben sich die Interessen zugunsten der Geschäftskunden und Werbepartner, während die Qualität für den Endnutzer sukzessive leidet. Google führte zunehmend subtilere und schwerer erkennbare Werbung ein. Schließlich folgt die dritte Phase, in der die Plattform den Nutzerwert auf ein Minimum reduziert, während sie gleichzeitig jeden Rest Nutzen erhält, der für eine Bindung von Nutzern und Geschäftspartnern essentiell ist. Diese Verfallserscheinung beschreibt Doctorow mit dem Begriff „homeopathisches Residuum“.
Aus den Gerichtsakten der letzten Google-Monopolklagen wird ersichtlich, dass der Suchalgorithmus absichtlich schlechter gemacht wurde, um Nutzer öfter suchen zu lassen und so mehr Anzeigen zu platzieren – und dabei gleichzeitig Werbekunden per illegalen Absprachen schlechter bezahlte Werbung aufzuzwingen. Das Ergebnis ist ein Übermaß an Werbeanzeigen, algorithmischem Spam und irrelevanten Inhalten – doch Nutzer bleiben gebunden, weil man kaum noch echte Alternativen sieht. Ein zentrales technisches Element, das diesen Zerfall ermöglicht, nennt Doctorow „Twiddling“. Die immense Kontrolle, die Unternehmen über Algorithmen und Preise behalten, erlaubt eine ständige, kaum nachvollziehbare Anpassung von Bedingungen und Angeboten. Am Beispiel von Gig-Economy-Anbietern wie Uber zeigt er auf, wie Fahrer durch ständige kleine und kaum wahrnehmbare Lohnänderungen manipuliert werden, bis sie zu niedrigen Konditionen akzeptieren.
Diese algorithmische Lohndiskriminierung funktioniert nur durch die Automatisierung und ist eine Form von systematischem „Wangentdiebstahl“, der von Menschen kaum in Echtzeit beobachtet oder bekämpft werden kann. Doctorow räumt mit einem weit verbreiteten Missverständnis auf: Dass „wenn Du nichts für das Produkt bezahlst, bist Du selbst das Produkt“. Diese Vereinfachung verschleiere oft die komplexeren Ursachen der Überwachungskapitalismus-Problematik. Es sei kein Automatismus, dass der Wechsel von werbefinanzierten zu kostenpflichtigen Angeboten allein ausreiche, um das Problem zu lösen. Er kritisiert Apple als vermeintliche reine Alternative: Zwar erlaubt Apple nun Nutzern, Drittfirmen-Tracking abzuschalten, gleichzeitig sammelt das Unternehmen selbst aber heimlich Daten für sein eigenes Werbenetzwerk und macht daraus ein hochprofitiertes Geschäft – ohne Offenlegung oder Opt-out-Möglichkeit.
Auch Hersteller und App-Anbieter würden wie Produkte behandelt und ausgebeutet. Solche monetären Extraktionen gehen weit über die Nutzer hinaus und umfassen auch Anbieter und sogar Patienten oder Pflegende im Falle der Gig-Economy-Apps. „Enshittifikation“ bezeichnet somit das Prinzip, dass im unregulierten Interesse der Profitmaximierung jeder verwertbare Stakeholder instrumentalisiert wird. Der Skeptiker könnte hinterfragen, ob Technologien selbst zum Problem geworden wären. Doctorow widerspricht dem entschieden: Technologie an sich sei nicht schuld, sondern die politischen Rahmenbedingungen, die seit Jahrzehnten sukzessive verändert wurden.
Noch in den letzten 40 Jahren habe es Warnungen vor solchen Entwicklungen gegeben. Statt sie zu beherzigen, hätten politische und wirtschaftliche Eliten Entscheidungen getroffen, die Monopole begünstigten und Innovation hemmten. Die Folgen dieser Fehlentwicklungen seien weltweit zu spüren – eine „perfekte Brutstätte“ für die Ausbreitung schlechter Praktiken. Diese führten zu Monopolisierung, Regulierungslücken und Überwachungskapitalismus, welche sämtliche Bereiche des Internets und darüber hinaus ergriffen und zum Nachteil der Allgemeinheit umzuwandeln drohen. Doch Doctorow gibt Hoffnung: Diese Situation sei keine unveränderliche Naturkatastrophe – sie ist reversibel.
Unternehmen wollen nur ihre Gewinne maximieren, doch sie tun dies nicht in einem rechtsfreien Raum. Es existieren vier wichtige Zwänge, die sie davon abhalten können, „totale Enshittifikation“ zu betreiben. Er nennt als erstes den Markt: In gesunden Systemen bestrafen Kunden Unternehmen mit sinkender Qualität und treiben so Wettbewerb an. Allerdings wurde die Auslegung des Monopolbegriffs seit den 1980er Jahren so verändert, dass Monopole als effizient und unvermeidlich angesehen werden; somit setzt man diesem Zwäng nicht entgegen. Firmen kaufen lieber Konkurrenten auf als mit ihnen zu konkurrieren und der Kapitalismus sei so zum „Aufkaufkapitalismus“ geworden.
Zweitens die Regulierung: Leider sind viele Aufsichtsbehörden von der Industrie „gekapert“ worden und schützen nicht mehr wirksam Verbraucher und Arbeitnehmer. Das Beispiel der US-amerikanischen Datenbroker zeigt, wie mangelnde Datenschutzgesetze fatale Konsequenzen haben. Seit 1988 wurde kaum neues Datenschutzrecht geschaffen, obwohl die Technologie sich dramatisch wandelte. Damit wurde eine „expensiv erkaufte Untätigkeit“ institutionalisiert. Drittens die Interoperabilität: Je offener ein System gestaltet ist, desto schwerer fällt es Unternehmen, Nutzer und Partner einzusperren oder zum Opfer von Restriktionen zu machen.
In der digitalen Welt ermöglicht universelle Rechnerarchitektur und offene Standards theoretisch eine einfache Wiederherstellung von Wettbewerb und Freiheit. Aber rechtliche Hürden wie der DMCA setzen umfangreiche Schranken. Reverse Engineering oder die Reparatur von Produkten wird kriminalisiert, sodass trotz technischer Möglichkeit, Missbrauch zu beheben, diese Chance verteuert oder verhindert wird. Viertens die Macht der Arbeiterschaft: Hoch qualifizierte Technikarbeitnehmer hatten über Jahrzehnte eine starke Verhandlungsposition, weil gut ausgebildete Fachkräfte knapp waren. Das hinderte Firmen daran, ihre Produkte bewusst zu verschlechtern.
Doch seit den Massenentlassungen seit 2023 hat sich das Blatt gewendet: Die Arbeiter können nicht mehr einfach „Nein“ sagen, denn viele wartende Bewerber stehen bereit. Die Gefahr besteht also, dass Unternehmen im Angesicht reduzierter Zwänge weiter „ershitifizieren“ und ihre profitgesteuerte Schrumpfspirale fortsetzen. Die traurige Realität ist eine globale „Omni-Shambolic Polykrise“, bei der große Technologiekonzerne bereit sind, den Planeten und grundlegende Menschenrechte für geringste Steuervorteile zu riskieren. Trotzdem sieht Doctorow global bereits Widerstand: Antitrust-Maßnahmen gewinnen weltweit wieder an Boden, von der EU über Kanada bis China. Gemeinschaftliche Zusammenarbeit dieser Institutionen und grüne Graswurzelbewegungen schaffen einen breiten Druck auf die Übermacht der Tech-Giganten.
Recht auf Reparatur-Gesetze wurden erlassen, wenngleich von Anti-Circumvention-Gesetzen behindert. Hier steht besonders der Druck des US-Handelsbeauftragten, der mit Zollandrohungen „umgesetzt“ wurde, im Fokus. Ein smarter Weg wäre jedoch, Patentgesetze auf API-Jailbreaks, Modifikationen oder Reverse Engineering zu lockern, um Innovation und Wettbewerb direkt zu stärken – anstatt sich auf nutzlose Preiskriege und politische Provokationen zu verlassen. Doctorow schließt mit einem Appell: Das „alte gute Internet“ war zwar komplizierter in der Bedienung, bot aber technische Selbstbestimmung. Web 2.
0 brachte breiten Zugang, aber führte zugleich in geschlossene, schwer verlassbare Ökosysteme. Er fordert, dass wir nun ein „neues gutes Internet“ schaffen, das beide Vorteile vereint: Offenheit und einfache Zugänglichkeit. Ein digitales Ökosystem, in dem Menschen zusammenkommen, um gemeinsamen Bedrohungen wie Klimakatastrophen, Faschismus und Überwachung zu widerstehen. Die Gestaltung dieses Internet steht uns offen – wir können es bauen und müssen es bauen. Sein Vortrag wurde mit langem Applaus aufgenommen, obwohl wohl nicht alle Sponsoren der PyCon die zugespitzte Kritik goutierten.
Doctorows Expertise und direkte Sprache machen seine Botschaften zu einem wichtigen Weckruf in einer Zeit, in der das Vertrauen in digitale Plattformen weiter schwindet. Die unsichtbaren Kräfte, die zur Enshittifikation führen, lassen sich nur durch bewusste politische, technische und gesellschaftliche Gegenmaßnahmen brechen. Nur so kann das Internet wieder zu einem verlässlichen Raum für Menschen und Innovation werden.