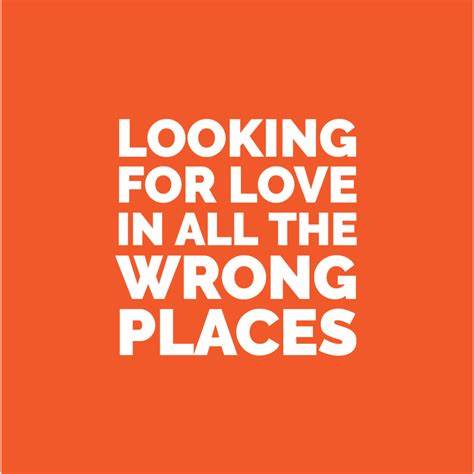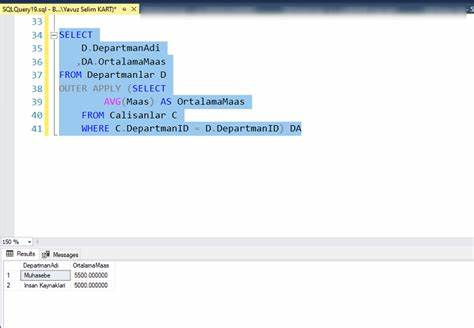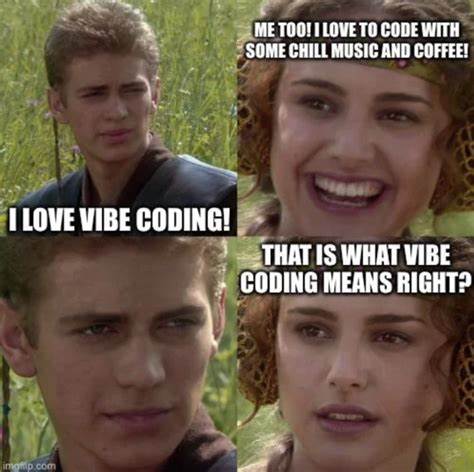In der glitzernden Welt Hollywoods und der globalen Unterhaltungsindustrie scheint Erfolg oft mit Reichtum Hand in Hand zu gehen – zumindest auf den ersten Blick. Doch ein genauerer Blick offenbart eine deutlich komplexere und ungerechtere Realität. Das meiste Geld konzentriert sich nicht bei den Künstlern, die Film, Musik oder Literatur erschaffen, sondern sitzt häufig bei den Führungsetagen, Managern und den sogenannten „Nepotismus-Babies“, also jenen mit familiären Verbindungen, die auf dem Silbertablett einen Fuß in die Tür bekommen. Gleichzeitig kämpfen viele talentierte Künstler trotz harter Arbeit und Anerkennung um finanzielle Sicherheit und strukturelle Absicherung. Diese Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf tiefere wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten, die weit über eine einzelne Branche hinaus Auswirkungen haben.
Einer der aktuellsten und eindrucksvollsten Fälle, der diese Schwachstellen illustriert, ist die junge Schauspielerin Sydney Sweeney. Trotz ihrer prominenten Rollen in Serien wie „Euphoria“ und „The White Lotus“ und einer Emmy-Nominierung kämpft sie gegen finanzielle Unsicherheiten und die Notwendigkeit, ständig Werbeverträge anzunehmen, um ihre Lebenshaltungskosten in Los Angeles zu decken. Die Schauspielerin stammt aus keiner vermögenden Familie, hat sich ihre Karriere über viele Jahre hart erarbeitet und ist dennoch nicht in der Lage, die sogenannten „freien Zeiten“ zu genießen, die viele ihrer Kollegen aus gutbürgerlichen oder reichen Familien nehmen können. Sweeneys Aussagen über ihre Unsicherheit, etwa, dass sie sich keinen sechsmonatigen Mutterschutz leisten kann, sorgten für heftige Diskussionen im Internet. Dabei wurde oftmals übersehen, dass sie in einer Branche arbeitet, die keine geregelten Sozialleistungen bietet und in der Freiberufler keinen festen Anspruch auf bezahlte Auszeiten, Gesundheitsversorgung oder Mutterschaftsurlaub haben.
Diese Bedingungen betreffen nicht nur Schauspieler, sondern Künstler aller Disziplinen. Es ist eine Realitätsprüfung für alle, die glauben, dass Ruhm und Erfolg automatisch mit Wohlstand verbunden sind. Dieser Mangel an sozialer Absicherung ist symptomatisch für das größere Problem der prekären Arbeitsverhältnisse im Kreativsektor und der ungleichen Verteilung der wirtschaftlichen Gewinne. Während viele Kulturschaffende am Limit ihrer Belastbarkeit arbeiten, fließen immense Geldsummen zu Führungskräften und Investoren, die oftmals weit entfernt von der eigentlichen künstlerischen Arbeit stehen. Der Vorstandsvorsitzende des Medienriesen Warner Bros.
Discovery etwa verdiente 2021 mehr als 246 Millionen US-Dollar, während viele Künstler weder von ihren Projekten leben noch einen Teil des allgemeinen Wohlstands abbekommen. Neben Hollywood ist eine ähnliche Schieflage auch in der Welt der Literatur und des Journalismus zu beobachten. Autoren und Schriftsteller, die ihre Texte veröffentlichen, sehen sich seit Jahrzehnten sinkenden Honoraren gegenüber. Ein literarisches Beispiel macht die Diskrepanz besonders deutlich: Ernest Hemingway erhielt im Jahr 1936 rund einen US-Dollar pro Wort, was inflationsbereinigt heutzutage mehr als 21 US-Dollar entspricht. Im Gegensatz dazu verdienen zeitgenössische Autoren für vergleichbare Stücke im besten Falle zwei bis fünf US-Dollar pro Wort und tun sich damit schwer, von ihrem Werk zu leben.
Selbst Bestsellerautoren genießen keine finanzielle Sicherheit, da die Vergütung für kreative Leistungen stetig sinkt. Diese scharfe Kluft erklärt sich auch dadurch, dass die Industrie heute weniger denn je passive Einkommensströme für Künstler generiert. In vergangenen Zeiten sicherte etwa die Wiederverwertung von Fernsehserien über Jahre hinweg Residualeinnahmen für Schauspieler und Autoren. Plattformen wie Streaming-Dienste und veränderte Geschäftsmodelle haben dieses System radikal verändert. Während die Branche weiter floriert und massive Umsätze einfährt, gelangen die Gelder vor allem zu den Eigentümern, Investoren und Top-Managern, nicht jedoch zu den kreativen Köpfen, die den eigentlichen Inhalt schaffen.
Die Struktur der Film- und Medienindustrie ist dabei auf Effizienz der Profite und Kostensicherheit ausgerichtet. Für die Verantwortlichen stellt die Vergütung klar kalkulierbarer Ausgaben einen zentralen Faktor dar, wobei die Personalkosten für Künstler oft als variable Größe behandelt werden. Dies führt zu einem System, in dem immer mehr Künstler, Schauspieler, Musiker und Autoren zusätzlich zu ihren eigentlichen Projekten Werbedeals und Nebenjobs annehmen müssen, um ihre Existenz zu sichern. Ein weiterer Punkt in der Diskussion um die ungleiche Vermögensverteilung ist die Rolle des Neids und der öffentlichen Wahrnehmung in sozialen Medien. Personen wie Sydney Sweeney, die trotz ihres Reichtums immer noch mit finanziellen Herausforderungen kämpfen, werden häufig kritisiert oder missverstanden.
Dabei wird verkannt, dass Wohlstand in dieser Branche stark vom Zugang zu familiären Ressourcen und sozialen Netzwerken abhängt. Die privilegierten „Nepo-Kids“ sind durch ihre familiären Verbindungen finanziell abgesichert und können sich auf höhere Planbarkeit und Sicherheit konzentrieren – eine Komfortzone, die für viele Künstler unerreichbar bleibt. Die Situation verdeutlicht eine größere gesellschaftliche Problematik: die Krise des amerikanischen Sozialsystems und das Fehlen vernünftiger Arbeitsrechte für Freiberufler. Während in vielen europäischen Ländern bezahlter Mutterschutz, Krankenversicherung und andere soziale Leistungen Standard sind, existieren solche Schutzmechanismen in den USA nur in sehr begrenztem Maße. Künstler und Kreative bleiben so im harten Wettbewerb gefangen, ausgebeutet und häufig ohne soziale Absicherung.
Der status quo wird durch steuerliche Entscheidungen und politische Rahmenbedingungen zusätzlich begünstigt, die das Vermögen der obersten Schichten fördern und ungleiche Wohlstandsverteilung weiter verschärfen. Darüber hinaus steht diese Ungleichverteilung auch im Kontext des sogenannten Great Wealth Transfer, dem Vermögenstransfer der Babyboomer-Generation an die jüngeren Generationen. Eine enorme Menge an Kapital wechselt den Besitzer – allerdings vornehmlich zugunsten derjenigen, die bereits privilegiert sind. Millionen Millennials ohne familiäres Vermögen stehen demgegenüber vor ungleich härteren Herausforderungen, während wohlhabende Erben quasi automatisch noch reicher werden, ohne aktiv zu arbeiten. Die künftige Generation der Stars und Künstler hat damit nicht nur schwierige finanzielle Startbedingungen, sondern auch immer weniger Aussicht auf einen fairen Anteil an den Erträgen ihrer Arbeit.
Diese Entwicklungen werfen fundamentale Fragen der Gerechtigkeit und der Wertschätzung von kreativem Schaffen auf. Warum erhalten Führungskräfte eines Unternehmens Millionen von Dollar jährlich, während diejenigen, deren Arbeit die Grundlage dieser Profite ist, oftmals gerade so über die Runden kommen? Wie entstehen und erhalten sich Systeme, die die Schöpfer der Inhalte von materiellem Wohlstand ausschließen? Und vor allem: Wie können Modelle entwickelt werden, die Kreativen finanzielle Stabilität und berufliche Nachhaltigkeit bieten, sodass künstlerisches Schaffen nicht nur ein prekäres Luxusproblem reicher Menschen bleibt, sondern eine tragfähige Existenzgrundlage für alle? Eine mögliche Antwort liegt in der Stärkung von Rechten für freie Künstler, verbindlichen Sozialversicherungen, fairen Vergütungsmodellen und einer gerechten Besteuerung großer Vermögen. Auch Medienkonzerne könnten vermehrt auf Transparenz und gerechte Beteiligung der Kreativen bestehen. Zugleich muss gesellschaftlich anerkannt werden, dass „Meritokratie“ in vielen Fällen eine Illusion ist, solange soziale Herkunft und Vermögen den Zugang und die Chancen dominieren. Nur durch eine umfassende Reform der Arbeitsbedingungen und Verteilungssysteme lässt sich verhindern, dass das Geld weiterhin an den falschen Stellen konzentriert bleibt.