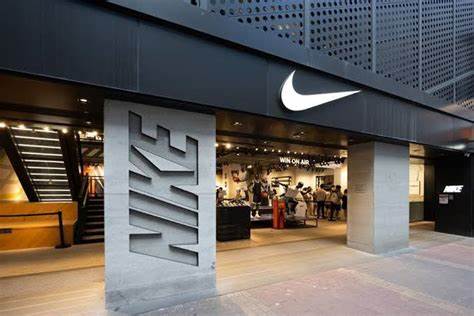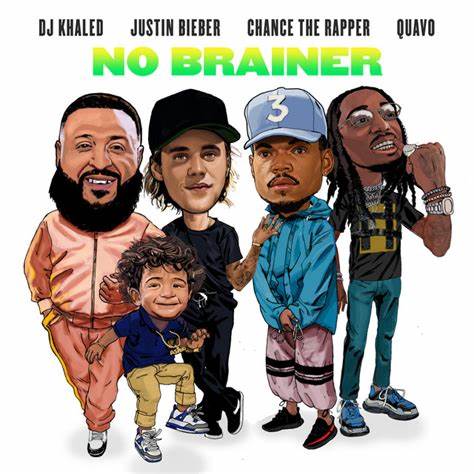Die immer weiter wachsende Welt der Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerte hat in den letzten Jahren zahlreiche neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Besonders Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, haben als neuartige digitale Sammlerobjekte und Investitionsmöglichkeiten großes Interesse geweckt. In diesem Kontext ist es besonders bemerkenswert, wenn ein globaler Konzern wie Nike ins Zentrum einer Kontroverse um Kryptowährungen und NFTs rückt. Im Jahr 2025 erhoben Käufer der Nike- und RTFKT-Digitalprodukte schwere Anschuldigungen gegen den Sportartikelhersteller und seine NFT-Tochter. Die Kläger werfen Nike vor, mit der Vermarktung des sogenannten Dunk Genesis CryptoKick NFTs Investoren getäuscht und systematisch ihre Rechte verletzt zu haben.
Die Vorwürfe reichen dabei von irreführender Werbung bis zum mutmaßlichen Verkauf unregistrierter Wertpapiere. Diese Klage unterstreicht die weitreichenden Herausforderungen, denen sich Unternehmen sowie Konsumenten im digitalen Finanz- und Kunstmarkt gegenübersehen. NFTs wurden erstmals in den frühen 2020er Jahren populär. Dabei handelt es sich um digitale Zertifikate, die einzigartige Gegenstände wie Kunstwerke, digitale Sammelobjekte oder virtuelle Güter in Spielen repräsentieren. Im Falle der Kooperation zwischen Nike und RTFKT ging es um ein speziell gestaltetes digitales Schuhwerk – die CryptoKick Sneakers –, die eine limitierte Zahl von Käufern erwerben konnte.
Diese NFTs waren als digitale Modeartikel zu verstehen, mit dem Versprechen, dass sie im Metaverse, einer virtuellen Welt, genutzt und gehandelt werden können. Die Kläger, die diese NFTs erwarben, geben an, von der Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit des Projekts überzeugt worden zu sein, insbesondere aufgrund der Beteiligung einer renommierten Marke wie Nike. Doch im Laufe der Zeit soll sich die Lage dramatisch verändert haben. Schon bald nach dem Verkaufsstart und dem anfänglichen Hype um die NFTs wurde bekannt, dass die digitale Tochter RTFKT plötzlich eingestellt und stillgelegt wurde. Das bedeutete für die NFT-Besitzer, dass die Haltbarkeit, Nutzbarkeit und Zukunftsperspektive ihrer digitalen Besitzrechte stark eingeschränkt oder sogar wertlos geworden seien.
Die Kläger beschreiben die Situation als einen „rug pull“, ein Begriff aus der Krypto-Szene, der den plötzlichen Abzug von Investorenkapital durch die Entwickler oder Initiatoren eines Projekts bezeichnet. Dabei fühlen sich Investoren im Stich gelassen und mit nutzlosen Token zurückgelassen, die ihren ursprünglichen Wert verloren haben. Ein zentraler Streitpunkt in dem laufenden Verfahren ist die Frage, ob die verkauften Nike NFTs als Wertpapiere einzustufen sind. Wertpapiere unterliegen strengen regulatorischen Vorgaben und müssen in den USA registriert sein, um den Schutz der Anleger und die Transparenz sicherzustellen. Die Kläger behaupten, dass Nike und RTFKT diese Registrierungspflichten umgangen haben, indem sie die Token als reine Sammlerobjekte oder digitale Kunst verbriefe und nicht als Anlageprodukte darstellten.
Diese Argumentation gewinnt an Bedeutung, da die Securities and Exchange Commission (SEC), die US-Börsenaufsicht, ihre Definition von digitalen Wertpapieren im Laufe der letzten Jahre mehrfach angepasst hat. Jedoch hat eine rückläufige Regulierungsstrategie unter der Trump-Administration für Verwirrung und rechtliche Grauzonen gesorgt, die Investoren und Verbraucherschutzorganisationen vor große Herausforderungen stellt. Experten wie Nicolle Lafosse, eine renommierte Anwältin für digitale Vermögenswerte, betonen, dass Klagen wie die gegen Nike eigentlich mehr Gewicht hätten, wenn die regulatorischen Grundlagen klarer definiert wären. Dennoch gelingt es den Klägern zunehmend, durch Klagen auf Landesebene auf Basis von Verbraucherschutzgesetzen eine juristische Handhabe zu finden, obwohl bundesrechtliche Wertpapiergesetze einen rechtlichen Flickenteppich hinterlassen. Die Nike-Affäre ist dabei exemplarisch für eine breitere Dynamik in der Krypto- und NFT-Branche, bei der zunehmend auch etablierte Großkonzerne mit Haftungsrisiken konfrontiert werden.
Während in früheren Jahren vor allem kleinere Start-ups oder dezentrale Projekte im Fokus von Betrugsinvestitionen standen, zeigen sich nun mit der Zunahme von Prominenten und globalen Marken im Krypto-Bereich größere Gefahren für breite Investorenkreise. Die Prozessparteien stehen nun vor Gericht im Bundesbezirksgericht von New York, wo die Kläger eine Sammelklage eingereicht haben. Ziel ist nicht nur die finanzielle Wiedergutmachung für die entstandenen Verluste, sondern auch die Etablierung klarerer Standards für den Umgang mit NFTs im regulatorischen Sinne. Für die Zukunft ist diese Klage von weitreichender Bedeutung. Der NFT-Markt boomt zwar weiterhin, doch die Frage nach der rechtlichen Einordnung dieser digitalen Assets bleibt zentral.
Eine ungeregelte oder ausufernde Praxis könnte das Vertrauen der Nutzer nachhaltig schädigen und zu massenhaften Käufen von wertlosen Token führen. Gleichzeitig wächst der Druck auf Gesetzgeber und Behörden, entsprechend klare Regeln und Kontrollen einzuführen, um sowohl Innovationen nicht zu behindern als auch Verbraucherschutz zu gewährleisten. Nike steht als globaler Marktführer im Fokus, doch die gesamte Mode- und Konsumgüterindustrie beobachtet den Ausgang mit Spannung. Vorangegangene Innovationsprojekte von Marken im Bereich Blockchain und NFTs wurden vielfach als Testballon gesehen, allerdings offenbaren sich an diesem Beispiel auch erhebliche Risiken und Fallstricke. Für Verbraucher stellt sich die dringende Frage, wie sie ihre Rechte wahren können und welche Sicherheitsmechanismen es im Umgang mit digitalen Produkten gibt.