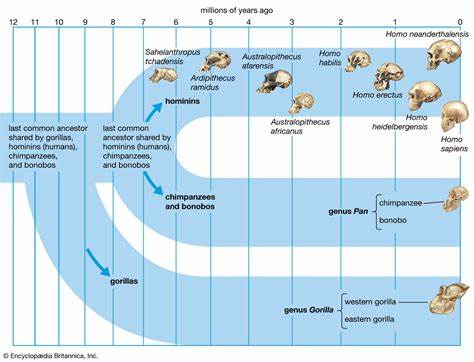Die amerikanische Fertigungsindustrie erlebt seit Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel. Während viele Politiker und Wirtschaftsexperten die Wiederbelebung der Industrie als essenziell für die wirtschaftliche Stabilität und Schaffung von Arbeitsplätzen ansehen, stehen sie vor einem ungewöhnlichen Dilemma, das sich um die Frage der Löhne dreht. Vielmehr als dass Löhne einfach zu hoch oder zu niedrig sind, zeigen sich komplexe Probleme, die ein grundlegendes Umdenken erforderlich machen, um die industrielle Basis der USA zu stärken. Das Lohnproblem in der US-Industrie ist paradox: Die Löhne sind gleichzeitig zu hoch für Hersteller und zu niedrig für potenzielle Arbeitnehmer. Seit den 1970er Jahren hat die Fertigung in den Vereinigten Staaten massiv an Bedeutung verloren.
Wurden damals noch knapp ein Viertel aller Arbeitsplätze in der Industrie angeboten, so sind es heute deutlich weniger. Der Verlust von über sechs Millionen Jobs in der Produktion ist nicht allein auf Automatisierung zurückzuführen, sondern auch auf die Verlagerung vieler Arbeitsplätze in Länder mit niedrigeren Lohnkosten. Dabei sind amerikanische Fertigungsarbeiter im internationalen Vergleich teuer, doch die Löhne in der US-Industrie sind gleichzeitig weniger attraktiv gegenüber anderen heimischen Branchen, was die Anwerbung neuer Fachkräfte erschwert. Ein zentrales Hindernis ist die Wettbewerbsfähigkeit der US-Produkte auf dem globalen Markt. Unternehmen, die in den USA produzieren, sehen sich mit höheren Lohnkosten konfrontiert im Vergleich zu Konkurrenten in Asien, Mexiko oder anderen aufstrebenden Volkswirtschaften.
Dort sind die Stundenlöhne teilweise nur ein Bruchteil der amerikanischen. Während ein amerikanischer Produktionsmitarbeiter durchschnittlich etwa das 16-fache dessen verdient wie sein vietnamesischer Kollege, sind die Kostenunterschiede gegenüber China oder Mexiko ebenfalls erheblich. Diese Lohnunterschiede zwingen US-Hersteller, stärker auf Automatisierung zu setzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Der Kapitalbedarf für moderne, hochautomatisierte Produktionsanlagen ist immens und ein Faktor, der Produktionsjobs in der Anzahl begrenzt. Dieser Umstand erklärt, warum die Industrie in den USA zunehmend auf komplexe und wertintensive Produkte spezialisiert ist, bei denen der Wert nicht in der physischen Arbeit, sondern in Wissen und Innovation liegt.
Hochentwickelte Güter wie Computerchips oder spezialisierte Maschinen erfordern weniger manuelle Arbeit, wobei der Hauptwert in der Entwicklung und Technologie liegt. Für einfache Produkte mit niedrigem Wertschöpfungsanteil hingegen sind automatisierte, aber kostspielige Anlagen weniger rentabel, weshalb deren Produktion oft in Niedriglohnländer verlagert wird. Gleichzeitig sind die Löhne in der Fertigungsindustrie für Arbeitnehmer im eigenen Land oft nicht attraktiv genug, wenn sie mit anderen Branchen konkurrieren müssen. Dies führt zu einer Arbeitsmarktsituation, in der genügend offene Stellen bestehen, aber nicht genügend qualifizierte oder motivierte Bewerber gefunden werden können. Für viele Arbeitnehmer erscheinen Jobs in der Industrie als weniger lukrativ oder attraktiv, insbesondere in einer Zeit, in der alternative Beschäftigungsmöglichkeiten im Dienstleistungssektor oder in technologisch geprägten Bereichen fehlen.
Die Lohnhöhe ist also zwar nicht der Grund für hohe Produktionskosten in den Fabriken, aber der Grund dafür, dass die Stellen oft nicht besetzt werden können. Das zweifache Lohnproblem wird weiter verschärft durch den aktuellen Arbeitsmarkt in den USA. Die Arbeitslosigkeit liegt mit etwa 4,2 % recht niedrig, was bedeutet, dass ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung bereits beschäftigt ist. Tendenziell gibt es keine ausreichende Zahl an verfügbaren Arbeitskräften, um die Fertigung auf das Niveau der 1970er Jahre, als über ein Fünftel aller Jobs in der Produktion angesiedelt war, zurückzubringen. Sogar wenn man davon ausgeht, dass einige Arbeitskräfte von anderen Branchen in die Industrie wechseln würden, ist die Differenz mit fehlenden 22 Millionen Arbeitsplätzen in der Fertigung riesig im Vergleich zu den aktuell rund 7 Millionen Arbeitslosen im Land.
Die Folge dieser Zwickmühle ist, dass die US-Industrie auf zwei Ebenen gleichzeitig arbeiten muss. Sie muss einerseits investieren, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Billiglohnländern mit Hilfe von Automatisierung und technologischer Innovation zu erhalten und auszubauen. Andererseits muss sie versuchen, mit attraktiveren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen Arbeitnehmer für die relativ wenigen noch vorhandenen manuellen Tätigkeiten zu gewinnen. Diese Herkulesaufgabe verlangt ein neues strategisches Denken, nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch politisch und gesellschaftlich. Politische Initiativen, wie die Einfuhrzölle, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps umgesetzt wurden, zielten darauf ab, Unternehmen und Arbeitsplätze zurück nach Amerika zu holen.
Doch solche Maßnahmen greifen nicht tief genug, wenn das grundlegende Lohnparadoxon ungelöst bleibt. Höhere Importkosten helfen den Herstellern nur bedingt, wenn der Zugang zu qualifiziertem Personal schwierig bleibt und die Kosten für automatisierte Anlagen das Investitionsvolumen enorm in die Höhe treiben. Gleichzeitig müssen politische Entscheidungen auch die Verbesserung der Ausbildung und Umschulung von Arbeitskräften stärker in den Fokus rücken, um die Qualifikationslücke zu schließen und den industriellen Wandel zu unterstützen. In diesem Zusammenhang spielen auch neue Technologien eine Schlüsselrolle. Automatisierung, Robotik und Künstliche Intelligenz können helfen, den Anteil von manuellen Arbeitsplätzen zu reduzieren, aber sie verlangen hochqualifizierte Mitarbeiter, die diese Technologien bedienen und weiterentwickeln.
Investitionen in Forschung und Entwicklung, Bildung und Qualifikation sind daher entscheidend, um die Industrie zukunftsfähig zu machen. Die Transformation der US-Industrie ist somit keine einfache Aufgabe, sondern ein langfristiger Prozess, der die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erfordert. Nur durch eine Kombination aus technologischer Innovation, vernünftiger Lohnpolitik und gezielter Förderung der Arbeitskräfte kann die Produktion in den USA gestärkt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die aktuelle Situation zeigt, dass es kein einfaches Patentrezept gibt. Zu niedrige Löhne behindern die Rekrutierung, zu hohe Löhne erschweren die Kostenstruktur und Wettbewerbsfähigkeit.
Diese Herausforderung verlangt kreative Lösungen, bei denen der Fokus nicht allein auf den Kosten, sondern ebenso auf der Wertschöpfung und dem Know-how liegen muss. Abschließend lässt sich sagen, dass die Zukunft der amerikanischen Fertigung davon abhängt, wie gut es gelingt, das Spannungsfeld zwischen Lohnkosten, Automatisierung und Fachkräftemangel auszugleichen und auf dieser Basis wieder wettbewerbsfähige Produktionsstrukturen aufzubauen.