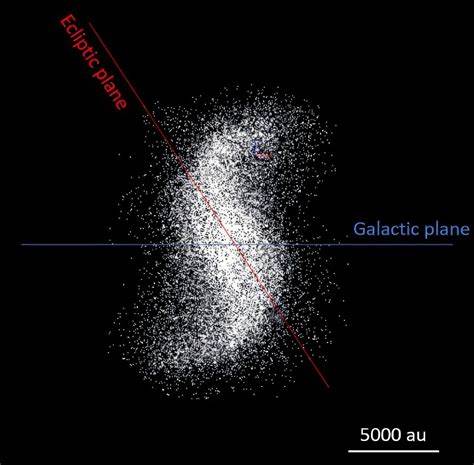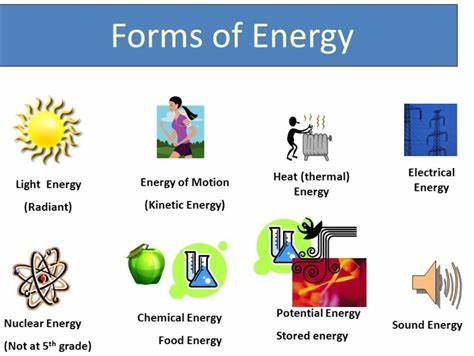In der heutigen vernetzten Welt ist die Verwendung privater IP-Adressen unverzichtbar für lokale Netzwerke. Fast alle Geräte, sei es im Haushalt, im Büro oder in Unternehmensumgebungen, verwenden private IP-Subnetze, um ihre lokalen Verbindungen zu ermöglichen. Diese privaten Adressen sind nicht öffentlich im Internet routbar, sondern dienen ausschließlich der Kommunikation innerhalb geschlossener Netzwerke. Durch die weite Verbreitung von NAT (Network Address Translation) werden diese privaten Adressen dann ins öffentliche Internet übersetzt. Trotz ihrer breiten Verwendung bringt diese Technik besondere Herausforderungen mit sich – vor allem wenn Netzwerke miteinander verbunden oder verschmolzen werden sollen.
Denn private IP-Bereiche können sich überschneiden, was zu schweren Konflikten führen kann. Die drei klassischen privaten IPv4-Adressbereiche, die gemäß RFC1918 festgelegt sind, umfassen die Bereiche 192.168.0.0/16, 10.
0.0.0/8 und 172.16.0.
0/12. Während viele Anwender die Auswahl ihres privaten IP-Blocks dem Zufall oder den Standardwerkseinstellungen ihres Routers überlassen, kann das bei der späteren Zusammenführung mehrerer Netzwerke problematisch sein. Zum Beispiel bei Firmenübernahmen, Heimnetzwerken mit VPN-Anbindungen oder der Verwaltung von Fernzugängen, wo die privaten Adressbereiche kollidieren können, ist eine strategische Auswahl der Subnetze von großer Bedeutung. Eine häufige Beschwerde ist die Überschneidung von Subnetzen in OpenWRT- oder anderen Standard-Routerkonfigurationen. So ist die oftmals verwendete 192.
168.1.0/24-Adresse ein typisches Beispiel für einen solchen Konflikt. Wenn sogar das Netzwerk eines Netzbetreibers oder eine LTE-Router-Konfiguration die gleiche Adresse nutzt, kann das dazu führen, dass VPN-Tunnel nicht mehr funktionieren oder dass ein sicherer Zugriff auf Arbeitsgeräte unmöglich wird. Die Lösung liegt darin, private IP-Bereiche zu identifizieren, die in der Praxis wenig oder gar nicht verwendet werden.
Dies ist allerdings leichter gesagt als getan, denn herkömmliche Empfehlungen oder das eigene Bauchgefühl bieten hier kaum eine belastbare Entscheidungsgrundlage. An dieser Stelle helfen Daten und konkrete Nutzungsanalysen, die Aufschluss darüber geben, welche Subnetze tatsächlich belegt sind und welche meist frei bleiben. Eine Quelle für solche Daten können beispielsweise Netzwerkgeräte wie die „WD Cloud“ NAS-Systeme sein, die neben normalen Funktionen auch TLS-Zertifikate ausstellen. Dabei vergibt das Gerät ein Zertifikat für seine interne lokale IP-Adresse als auch für die öffentliche WAN-IP. Die Analyse dieser Datenmengen zeigt auf, welche privaten IP-Subnetze überwiegend verwendet werden.
Mit einer Basis von fast 1,8 Millionen Geräten aus einer Vielzahl von Heim- und Büroumgebungen lassen sich aussagekräftige Erkenntnisse hinsichtlich der Verteilung der privaten IP-Adressen gewinnen. Die Auswertung zeigt klar, dass der Bereich 192.168.0.0/16 mit Abstand der am meisten eingesetzte private Adressraum ist.
Viele Hersteller von Heimroutern setzen hier auf voreingestellte oder werksseitige IP-Adressbereiche wie 192.168.1.0/24, 192.168.
0.0/24 oder 192.168.178.0/24.
Der Grund hierfür liegt in der Benutzerfreundlichkeit: Endnutzer müssen diesen Bereich selten einmal ändern oder anpassen. Diese häufig genutzten Default-Subnetze sind aber auch genau die Punkte, an denen ein hohes Konfliktpotenzial bei der Vernetzung unterschiedlicher Netze entsteht. Im Gegensatz dazu stehen die Adressbereiche 172.16.0.
0/12 und 10.0.0.0/8. Trotz ihrer größeren Größe und des größeren Adressraums schneidet der 172er-Bereich hinsichtlich der Nutzung weitaus geringer ab.
Nur etwa 1,2 Prozent der analysierten Geräte verwenden diesen Bereich. Auch der 10.0.0.0/8-Bereich ist, obwohl er theoretisch enorme Kapazitäten bietet, in vielen Teilen kaum genutzt.
Dieses Wissen legt nahe, dass insbesondere diese Bereiche besonders gute Kandidaten für unbesetzte oder wenig genutzte private IP-Subnetze sind. Die Schwierigkeit bei der Auswahl eines privaten Subnetzes liegt darin, dass man bei den kleinen 192.168.x.x-Bereichen nur 256 mögliche /24-Subnetze hat, die sich in der Praxis häufig überschneiden.
Im Vergleich dazu bieten die anderen beiden Bereiche – besonders 10.0.0.0/8 – tausende von /24-Subnetzen, die sowohl aus technischer Sicht komfortabel getrennt werden können, als auch organisatorisch ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen. Darüber hinaus lässt sich anhand dieser Daten auch ein klares Bild über die Verteilung der populärsten Subnetze erstellen.
Router-Hersteller wie Netgear, TP-Link, FritzBox, Huawei oder Google WiFi setzen dabei auf bestimmte Subnetze, die sich in den Daten widerspiegeln. So etabliert sich durchaus eine gewisse Mustererkennung, welche IP-Blocks in welchen Heimnetzwerken Verwendung finden. Wer unkontrolliert ein sogenanntes „Standard-Subnetz“ verwendet, steckt damit mittendrin in einem potentiellen Überschneidungsproblem. Netzwerkadministratoren und IT-Verantwortliche profitieren von einer datengetriebenen Herangehensweise bei der Vergabe privater Subnetze. Durch das Einbeziehen von realen Nutzungsdaten können sie Subnetze gezielt auswählen, die noch wenig belegt sind.
So minimiert sich das Risiko von IP-Adresskonflikten bei der Verbindung verschiedener Standorte oder bei virtuellen Netzwerken. Neben Aspekten der Konfliktvermeidung verbessern solche Datenanalysen auch die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Netzwerken. Gerade bei Out-of-Band-Netzwerken, die zur Verwaltung von kritischen Infrastruktur eingesetzt werden, ist die Unüberschneidung von IP-Adressbereichen essenziell. Ein OOB-Netzwerk mit einem nicht verwechselbaren, einzigartigen Subnetz kann selbst dann erreichbar bleiben, wenn Standardnetzwerke aufgrund von Fehlkonfigurationen oder Angriffsversuchen ausfallen. Für Anwender, die ihre eigenen Netze konfigurieren möchten, empfiehlt es sich daher, nicht auf Standardvorgaben oder allgemeine Empfehlungen zu vertrauen, sondern die Möglichkeiten des riesigen Adressraums im 10.
0.0.0/8 oder 172.16.0.
0/12-Bereich zu nutzen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auf frei verfügbare Datensätze zurückgreifen, die eine Übersicht über belegte und unbesetzte Subnetze bieten. Dadurch kann gezielt ein Subnetz ausgewählt werden, das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit dem privaten Netz eines anderen Systems kollidiert. Ein weiterer Vorteil dieser datenbasierten Auswahl ist die langfristige Stabilität: Netzwerke, die auf ungewöhnlichen, aber belegungslosen Subnetzen beruhen, sind weniger anfällig für Änderungen in der Umgebung, beispielsweise beim Anschluss neuer Geräte, Router-Updates oder der Zusammenführung mit anderen Standorten. Fazit: Die Wahl privater IP-Subnetze ist mehr als eine triviale Einstellungsfrage.
Sie kann den Unterschied ausmachen zwischen stabilen, konfliktfreien Netzwerken und komplizierten, störanfälligen Umgebungen. Datengetriebene Einblicke in die tatsächliche Nutzung der privaten Adressräume bieten eine fundierte Grundlage, um geeignete Subnetze zu definieren, die in der Praxis selten oder gar nicht verwendet werden. Vor allem die größeren Subnetze im 172.16.0.