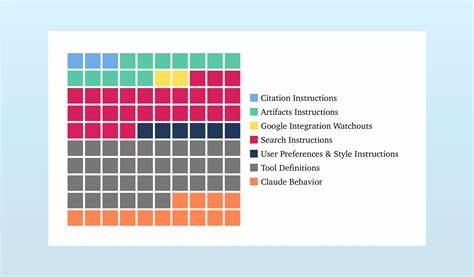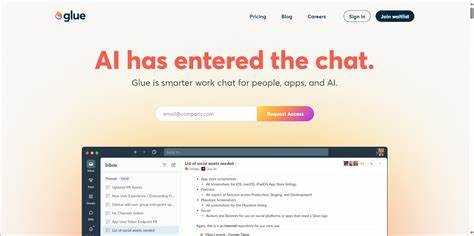Der natürliche Zinssatz ist ein zentrales Konzept in der Makroökonomie, das oft als der Zinssatz definiert wird, bei dem die Wirtschaft im Gleichgewicht ist, ohne inflationären oder deflationären Druck. Seit Jahrzehnten wird darüber diskutiert, wie hoch dieser natürliche Zinssatz tatsächlich ist und welche Faktoren seinen Wert bestimmen. Im Jahr 2005 legten Mathew Forstater und Warren Mosler mit ihrem Papier "The Natural Rate of Interest is Zero" eine provokante These vor, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: Unter den heutigen institutionellen Rahmenbedingungen, insbesondere bei einer vom Staat ausgegebenen Währung mit flexiblem Wechselkurs, liegt der natürliche Zinssatz faktisch bei null. Diese Vorstellung stellt viele herkömmliche Annahmen über Geldpolitik und Zinssteuerung infrage und hat wichtige Auswirkungen auf wirtschaftspolitische Entscheidungen.Der Begriff "natürlicher Zinssatz" ist ursprünglich von Ökonomen wie Knut Wicksell geprägt worden und steht für den Zinssatz, bei dem das Gleichgewicht zwischen Ersparnis und Investition ohne unerwünschte Schwankungen des Preisniveaus herrscht.
Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Naturgesetz, sondern vielmehr um ein Konzept, das im Kontext bestimmter ökonomischer Institutionen und Bedingungen definiert ist. Forstater und Mosler betonen, dass die Verwendung des Begriffs "natürlich" oft missverstanden wird, sodass es wichtig ist, den institutionellen Hintergrund zu berücksichtigen und nicht von einer universellen Gesetzmäßigkeit auszugehen.Im Kern ihrer Argumentation steht die Erkenntnis, dass moderne Volkswirtschaften, die eine von einem souveränen Staat kontrollierte Währung nutzen, die vom Staat per Steuersystem und Monopol über die Währungsausgabe definiert wird, eine völlig andere Dynamik aufweisen als Volkswirtschaften mit festen Wechselkursen oder goldgedeckter Währung. Ein von Forstater und Mosler beschriebener "tax-driven" Währungsansatz besagt, dass die staatliche Fähigkeit, Steuern zu erheben und die Währung auszugeben, dafür sorgt, dass Geld erst durch Steuerverpflichtungen innerhalb der Wirtschaft entsteht und zirkuliert.Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines positivem Zinsniveaus als Ausgleichsfunktion zwischen Ersparnis und Investition, da die Währung selbst keine Knappheit besitzt, sondern letztlich als monopolistisches Zahlungsmittel vom Staat unbeschränkt bereitgestellt werden kann.
Die Folge ist, dass der natürliche Zinssatz, der ansonsten wegen Inflationserwartungen oder Risikoaufschlägen positiv ausfallen könnte, in einem solchen institutionellen Umfeld bei null tendiert. Dieses Verständnis steht im Gegensatz zu traditionellen Lehren, die häufig von einem positiven natürlichen Zinssatz ausgehen und die Zinssteuerung als primäres Instrument der Geldpolitik ansehen.Die Bedeutung flexibler Wechselkurse in diesem Kontext ist nicht zu unterschätzen. Unter Bedingungen fester Wechselkurse oder Währungsbindungen an Gold oder andere Währungen entstehen externe Beschränkungen für die Geldpolitik eines Staates, die den Handlungsspielraum verringern. Fixierte Wechselkurse führen dazu, dass die Geldmenge und der Zinssatz de facto durch internationale Kapitalströme und Währungsreserven bestimmt werden, was sich unmittelbar auf die Zinslandschaft auswirkt.
Bei flexiblen Wechselkursen hingegen kann die Zentralbank als Emittent der Landeswährung autonomen Einfluss auf die Geldpolitik nehmen, ohne an externe Zwänge gebunden zu sein.Die Arbeit von Forstater und Mosler erweitert zudem das Verständnis von Zinssätzen als reinen Finanzmarktphänomenen hin zu einem institutionalistischen Blickwinkel. Wenn der Zinssatz nicht länger als „natürliches“ Marktgleichgewicht zwischen Sparern und Investoren erklärt wird, sondern als Ergebnis von staatlichen Institutionen und deren Regulierung, verändert sich die wirtschaftspolitische Perspektive grundlegend. Zinssätze sind keine festen Größen, die sich einfach aus dem Angebot und der Nachfrage nach Kapital ergeben, sondern variieren stark in Abhängigkeit von den durch den Staat gesetzten Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung des Währungssystems.Diese Erkenntnis hat zahlreiche Konsequenzen für die Geldpolitik.
Wenn der natürliche Zinssatz tatsächlich bei null liegt, wird die Strategie der Zentralbanken, durch Zinsschritte die Wirtschaft zu stabilisieren, weniger effektiv oder sogar obsolet. Die Notwendigkeit der Zinssteuerung als Hebel zur Bekämpfung von Inflation oder zur Belebung des Wachstums kann dadurch relativiert werden. Stattdessen tritt die fiskalische Politik in den Vordergrund: Staatsausgaben, Steuersenkungen oder Investitionsprogramme können bei weitgehend vernachlässigbarem Zinssatz direkt zur Förderung der Wirtschaftsaktivität genutzt werden.Auch in Zeiten von Nullzinsumfeld und quantitativer Lockerung zeigt sich die Relevanz dieser Theorie. Viele Industrie- und Schwellenländer erleben anhaltend niedrige oder sogar negative Realzinsen, was orthodoxe Modelle nur schwer erklären können.
Die Betrachtung der Geldpolitik innerhalb eines Systems staatlicher Währung, das nicht durch Gold oder externe Bindungen limitiert ist, bietet dabei eine stimmige Erklärung. Die Existenz einer Mindestverzinsung als „natürliche“ Grenze wird hinterfragt, was wiederum die Debatte darüber befeuert, wie nachhaltige und effektive wirtschaftliche Steuerung aussehen soll.Weiterhin wird durch die Argumentation von Forstater und Mosler auch die Rolle von Finanzintermediären und Banken neu bewertet. Wenn der natürliche Zinssatz bei null liegt, entsteht die Frage, welche Funktion Zinssätze bei der Mittelallokation in einer Volkswirtschaft tatsächlich erfüllen. Auch wenn Banken weiterhin Kredite vergeben und Zinsen verlangen, um Risiken abzudecken und Prozesse zu steuern, relativiert sich der gesamtwirtschaftliche Zinsdruck, der z.
B. durch Sparanreize oder Investitionsentscheidungen entsteht.Kritiker dieser Position argumentieren oft damit, dass trotz staatlicher Währungsmonopolstellung gesamtwirtschaftlich positive Zinssätze notwendig sind, um Inflation einzudämmen oder die Ressourcenallokation zu optimieren. Sie verweisen zudem auf historische Daten, die zeigen, dass Zinsen in der Realität selten bei null liegen. Dennoch bleibt die theoretische Argumentation von Forstater und Mosler ein wichtiger Beitrag, der die Bedingungen und Wirkungsvollheit unterschiedlichster wirtschaftspolitischer Maßnahmen hinterfragt und zur Reflexion über das heutige Geldsystem anregt.
Abschließend lässt sich sagen, dass die These eines natürlichen Zinssatzes von null in einer Welt mit flexibler staatlicher Währung und steuerlich bestimmten Geldkreisläufen eine Herausforderung für bestehende makroökonomische Paradigmen darstellt. Sie betont die Rolle der Institutionen und der Geldpolitik jenseits marktmechanischer Erklärungen und legt nahe, fiskalische Instrumente stärker in den Fokus zu rücken.Die Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für die Gestaltung von Wirtschaftspolitik, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Stagnation und ineffizienter Ressourcenverwendung. Sie fordern eine vollständige Neubewertung des Zinsbegriffs und dessen Funktion, wobei die Potenziale einer Steuerung der Wirtschaft durch staatlich definierte Währungssysteme und deren politische Steuerung hervorgehoben werden.Für zukünftige Forschungen und Debatten bietet das Papier von Forstater und Mosler damit einen wertvollen theoretischen Rahmen, der vor allem in Zeiten weltweiter Niedrigzinsen und wirtschaftlicher Unsicherheiten an Bedeutung gewinnt.
Die Auseinandersetzung mit der Frage, ob der natürliche Zinssatz tatsächlich bei null liegt, bleibt relevant, um wirtschaftspolitische Maßnahmen fundiert und wirksam zu gestalten und die Volkswirtschaften widerstandsfähiger und gerechter zu machen.
![The Natural Rate of Interest is Zero (2005) [pdf]](/images/7AC88C50-BF25-4FC2-BD69-1ACFDBF5B94B)