Die Welt der logischen Rätsel und mathematischen Probleme fasziniert immer wieder Menschen aus der Informatik und darüber hinaus. Einer der bekanntesten Klassiker ist das N-Damen-Problem, das häufig als Benchmark für Algorithmik und constraint-basierte Programmierung genutzt wird. Doch Varianten dieses Problems bieten neue Herausforderungen und spannende Möglichkeiten zur Anwendung moderner Technologien. Ein solches Beispiel ist die Variante „LinkedIn Queens“, die trotz ähnlicher Grundprinzipien komplexere Regeln und eine instinktiv anspruchsvollere Modellierung erfordert. Dabei erweist sich der Einsatz von SMT-Solvern als besonders vielversprechend und vereinfacht die Arbeit deutlich gegenüber traditionellen SAT-Solvern.
LinkedIn Queens – eine knifflige Puzzle-Variation Grundsätzlich basiert die LinkedIn Queens Variation auf einem NxN-Gitter, in dem N Damen platziert werden sollen. Die Einschränkung besteht darin, dass sich genau eine Dame in jeder Zeile, jeder Spalte und in jeder der vorgegebenen Regionen befindet. Das Besondere an diesem Rätsel, im Gegensatz zum klassischen N-Damen-Problem, sind andere Regeln für angrenzende Positionen. So dürfen beispielsweise Damen nicht diagonal angrenzend zueinander stehen – ein Unterschied zu den gewohnten Zugmöglichkeiten der Schachdame, der das Rätsel an sich neu definiert. LinkedIn Queens ist eng verwandt mit dem Spiel Star Battle, das zwar ähnliche Layouts nutzt, bei dem jedoch die Anzahl der einzusetzenden Figuren pro Bereich variabel ist – meist zwei anstelle von einer.
Diese zusätzlichen Einschränkungen machen die Aufgabe deutlich herausfordernder als das ursprüngliche N-Damen-Problem. Die Komplexität steigt durch die Notwendigkeit, unterschiedliche Regionen zu definieren, die nicht zwangsläufig regelmäßig geformt sind, und durch das Verbot angrenzender Diagonalen, was keine leichte Kodierung zulässt. Diese Aspekte gegenüberzustellen und abzubilden verlangt nicht nur theoretisch ein gutes Modell, sondern auch die Fähigkeit, dieses effizient zu lösen. Warum SMT anstelle von SAT? Die traditionelle Herangehensweise bei solchen logischen Problemen ist die Übersetzung in SAT, also die Formulierung als Erfüllbarkeitsproblem über Boole’sche Variablen. Dabei wird der Spielzustand so beschrieben, dass jede mögliche Position eine Vielzahl von Variablen mit Wahrheitswerten besitzt, die dann durch eine Vielzahl von Klauseln miteinander verknüpft werden.
Für das LinkedIn Queens Problem kann das schnell sehr unübersichtlich werden, da für jedes Feld eine Variable existiert und Klauseln formuliert werden müssen, die sicherstellen, dass die Restriktionen eingehalten werden. SMT (Satisfiability Modulo Theories) hingegen arbeitet auf einer höheren Abstraktionsebene. SMT-Solver wie Z3 oder CVC5 erlauben es, Variablen nicht nur als Boole’sche Werte zu definieren, sondern auch als Ganzzahlen, Arrays oder andere komplexe Datentypen. Dadurch lassen sich viele Anforderungen des Problems auf einer natürlicheren Ebene formulieren, was die Modellierung erheblich erleichtert und das Gesamtsystem übersichtlicher macht. Ein Beispiel hierfür ist die Positionierung der Damen.
Wo SAT häufig eine NxN Matrix von Boole’schen Variablen benötigt, in der für jede Kombination aus Zeile und Spalte eine Variable anzeigt, ob dort eine Dame ist oder nicht, kann SMT einfach einen Vektor von Ganzzahlen erstellen, in dem jede Variable die Spalte der Dame in der jeweiligen Zeile bezeichnet. Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit, das „genau eine Dame pro Zeile“-Problem durch zusätzliche Klauseln zu lösen, da diese Bedingung durch das Datenmodell bereits implizit gegeben ist. Der Umgang mit Spalten ist ebenso eleganter. Statt aufwendiger Klauselmengen für verschiedene Variablen nutzt man bei SMT eine Distinct-Bedingung auf die Spaltenindizes, die direkt sicherstellt, dass keine Spalte mehrfach besetzt wird. Die Logik des Puzzles – jeweils eine Dame pro Zeile, Spalte und Region ohne diagonale angrenzende Damen – wird somit beispielhaft klarer und prägnanter ausgedrückt.
Herausforderungen bei der Modellierung der Regionen Die Schwierigkeit bei LinkedIn Queens liegt insbesondere in den unregelmäßigen Regionen, die das NxN-Brett in Teilbereiche teilen. Diese Regionen können Formen aufweisen, die weit vom einfachen quadratischen Raster entfernt sind, was es erschwert, sie programmgesteuert zu generieren oder zu kodieren. In der Praxis bedeutet das, dass für jede Region die möglichen Felder manuell definiert werden müssen. Diese manuelle Definition ist nicht nur fehleranfällig, sondern erschwert auch die Wiederverwendbarkeit und Skalierbarkeit des Lösungsansatzes. Um ein konsistentes und korrektes Modell zu gewährleisten, ist es wichtig, umfangreiche Plausibilitätsprüfungen durchzuführen.
So wird überprüft, ob alle Felder des Brettes genau einer Region zugeordnet wurden und ob sich Regionen nicht überlappen. Diese Checks können mittels einfacher Mengenoperationen und Kreuzvergleichen verwirklicht werden und helfen, Fehler im Modell frühzeitig zu entdecken. Im konkreten Beispiel werden Regionen als Wörterbücher mit Listen von Tupeln dargestellt, die Zeilen- und Spaltenkoordinaten enthalten. Jeder Tupel steht für die Position eines Feldes in der Region. In der finalen SMT-Formulierung müssen dann für jede Region Bedingungen aufgestellt werden, die garantieren, dass sich genau eine Dame darin befindet.
Hierfür wird eine logische Oder-Verknüpfung über alle Positionen eines Bereichs formuliert, die besagt, dass die Dame im jeweiligen Bereich an mindestens einer dieser Positionen sein muss. Obwohl diese Implementation relativ direkte Ergebnisse ermöglicht, ist sie in der Ausführung nicht optimal. Programmierexperten können hier sicherlich Ansätze finden, um durch effizientere Darstellung oder algorithmische Vereinfachungen den Aufwand zu reduzieren, doch das Grundproblem der Verteilung der Dame auf komplexe Regionen bleibt anspruchsvoll. Effizienz und Vergleich mit klassischen SAT-Methoden Ein relevanter Aspekt ist die Performance der Lösung. SAT-Solver sind über Jahrzehnte optimiert worden und glänzen bei vielen Problemen, gerade wenn die Umwandlung in Boole’sche Variablen gut gelingt.
So existieren sehr schnelle Solver wie Glucose, die komplexe Puzzle in Sekunden oder gar Millisekunden lösen können. SMT-Lösungen sind oft intuitiver und leichter verständlich, benötigen jedoch manchmal mehr Rechenzeit. Die Verwendung von Integer-Variablen und höherwertigen Theorien wie Arithmetik verursacht eine höhere Belastung für den Solver als reine Boolesche Operationen. Dennoch lohnt sich dieser Mehraufwand besonders bei der Modellierung komplexer Probleme, bei denen die SAT-Codierung sehr umständlich oder kaum wartbar wäre. In der Praxis kann die Wahl zwischen SAT und SMT auch davon abhängen, wie wichtig Entwicklungszeit und Wartbarkeit sind.
Für Unternehmen und Entwickler, die schnell Prototypen oder flexible Modelle benötigen, sind SMT-Solver mit ihren eleganteren Ausdrucksmöglichkeiten eine attraktive Alternative. Für kritische Anwendungen mit Fokus auf Geschwindigkeit kann hingegen der SAT-Ansatz vorteilhafter sein. Perspektiven und zukünftige Entwicklungen Die Kombination von logischen Rätseln und formalen Methoden aus der Informatik zeigt auf, wie breit und tief das Feld der Constraint-basierte Programmierung und der Einsatz von SMT und SAT ist. Projekte wie das Lösen von LinkedIn Queens verdeutlichen, dass selbst traditionelle Probleme in neuen Varianten neue Anforderungen an die Modellierung und Lösungsmechanismen stellen. Die Weiterentwicklung von SMT-Solvern ist ein dynamischer Prozess.
Neben Verbesserungen in der Algorithmik und Performance wird auch verstärkt daran gearbeitet, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Bequeme APIs, Unterstützung für komplexere Datentypen oder bessere Debugging-Methoden sind Schwerpunkte, die auch Anfängern den Zugang erleichtern. Darüber hinaus können Ansätze wie die Verwendung von Vektorvariablen, Abstraktionen über Regionen und automatisierte Regionserkennung in Zukunft dafür sorgen, dass das manuelle Festlegen von Regionen entfällt. Intelligente Vorverarbeitung oder visuelle Tools könnten ebenfalls die Arbeit an solchen Problemen stark erleichtern. Für Programmierer, Mathematiker und Puzzle-Begeisterte eröffnet die Kombination von logischen Rätseln und SMT eine reizvolle Welt, in der theoretische Fortschritte direkt zu praktischen Anwendungsideen führen.
Das LinkedIn Queens Beispiel steht hier stellvertretend für eine große Klasse von Problemen, die durch moderne SMT-Techniken greifbar bleiben und gleichzeitig das Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten solcher Methoden erweitern. Fazit LinkedIn Queens mit SMT zu lösen zeigt exemplarisch, wie moderne formale Methoden komplexe logische Probleme vereinfachen und übersichtlicher machen können. Der Wechsel von der klassischen SAT-Modellierung zu SMT-Vektoren erlaubt es, die Problembeschreibung natürlicher zu gestalten und viele Zwischenschritte zu eliminieren. Trotz der Herausforderungen bei der Modellierung von Regionen und der vergleichsweise langsameren Lösungsgeschwindigkeit bietet SMT einen enormen Vorteil bei der Verständlichkeit und Wartbarkeit des Codes. Diese Eigenschaften machen SMT-Solver für Entwickler attraktiv, die Wert auf klare und flexible Formulierungen legen, und bieten gleichzeitig eine spannende Grundlage für weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich formaler Verifikation und constraint-basierter Programmierung.
Die Arbeit mit LinkedIn Queens bestätigt, dass komplexe Puzzle und formale Methoden eine fruchtbare Verbindung eingehen können und dadurch neue Lösungen entstehen, die sowohl technisch als auch konzeptionell überzeugen.




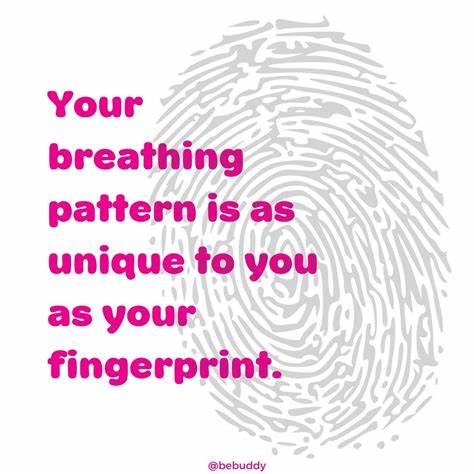
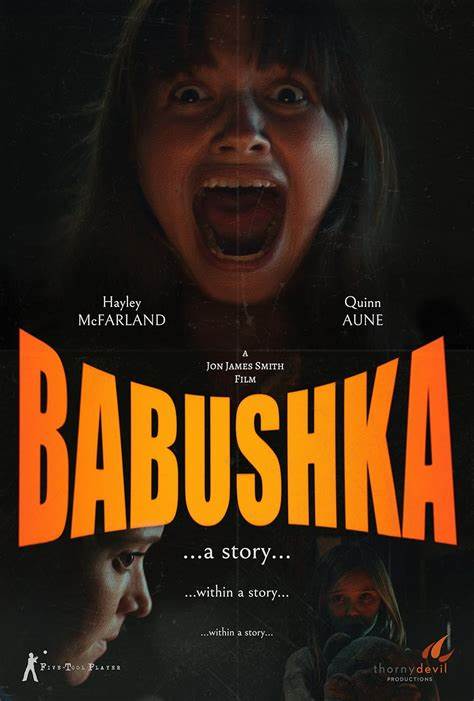
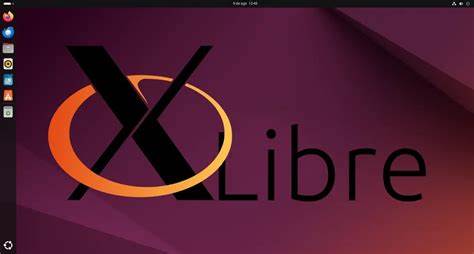
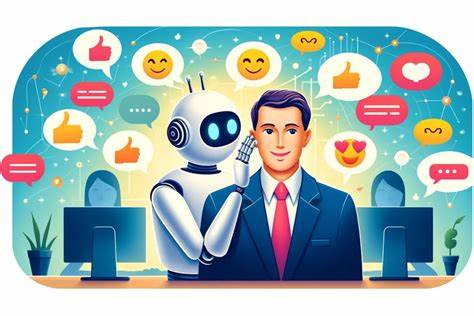

![WWDC25: Verify Identity Documents on the Web (MDL, MDoc, etc.) [video]](/images/8E85BF01-FC4A-4D03-A6BE-A1813AFD1C6E)