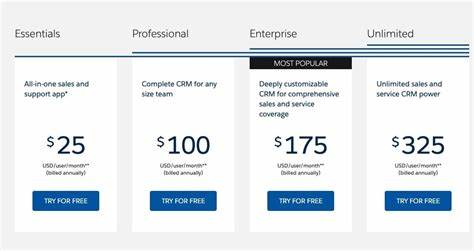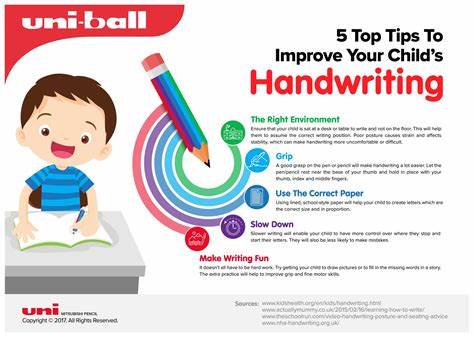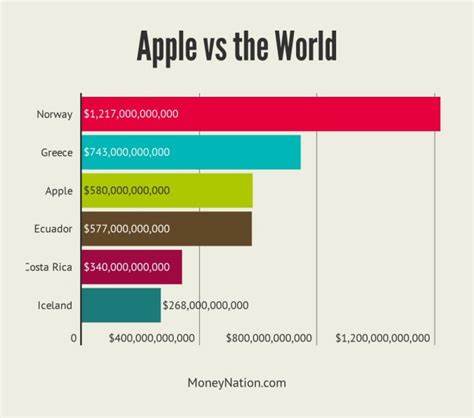Die Welt der Anwendungssicherheit steht vor einer tiefgreifenden Herausforderung, die sich im Laufe der letzten Jahre stetig verschärft hat. Moderne Unternehmen, insbesondere solche mit komplexen IT-Architekturen und agilen Entwicklungszyklen, sind mehr denn je mit einer Flut von Sicherheitswarnungen konfrontiert – eine Flut, die die meisten IT- und Security-Teams kaum bewältigen können. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen auf schockierende Weise, dass nahezu 95 % der sogenannten AppSec-Fixes kaum zur Risikominderung beitragen und damit oft Zeit, Geld und Ressourcen unnötig binden. Diese Erkenntnisse werfen nicht nur einen Schatten auf bisherige Sicherheitspraktiken, sondern fordern auch ein radikales Umdenken in der Art und Weise, wie Anwendungssicherheit gemanagt und priorisiert wird. Die Wurzeln des Problems liegen darin, dass Sicherheitsteams seit Jahren vor allem auf die reine Erkennung von Schwachstellen setzen.
Fortschritte in der Technologie – von statischen Analyse-Tools über Schwachstellenscanner bis hin zu umfassenden CVE-Datenbanken – führten unweigerlich zu einer überwältigenden Anzahl von Warnmeldungen. So stiegen die gemeldeten Sicherheitslücken dramatisch an, doch die meisten von ihnen sind von geringer oder gar keiner Relevanz für die reale Ausnutzbarkeit und den tatsächlichen Schaden, den sie anrichten könnten. Laut dem Application Security Benchmark Report von OX Security aus dem Jahr 2025 belief sich die durchschnittliche Anzahl der Sicherheitsmeldungen pro Unternehmen auf fast 570.000 pro Jahr – doch von diesen waren nur rund 200 tatsächlich kritisch und handlungsrelevant. Das führt zu einem Phänomen, das in der Branche als Alert Fatigue bekannt ist: Die Sicherheitsteams sind zwangsläufig überfordert und beginnen, Warnungen weniger ernst zu nehmen, was wiederum das Risiko erhöht, dass echte Bedrohungen übersehen werden.
Gleichzeitig entstehen Spannungen zwischen Sicherheits- und Entwicklerteams. Entwickler fühlen sich durch unzählige vermeintlich dringliche Aufforderungen zur Fehlerbehebung ausgebremst, was nicht nur die Produktivität verringert, sondern auch die Zusammenarbeit erschwert. Ein weiterer Faktor, der die Situation verschärft, ist die rasante Zunahme an Anwendungskomplexität und Angriffsflächen. Wo im Jahr 2015 noch knapp 6.500 CVEs veröffentlicht wurden, sind es 2024 bereits weit über 200.
000 – mit allein 40.000 neuen Schwachstellen im letzten Jahr. Viele dieser Schwachstellen betreffen allerdings Codeabschnitte, die kaum oder gar nicht genutzt werden, beispielsweise veraltete oder nur in der Entwicklung eingesetzte Abhängigkeiten. Es verwundert daher nicht, dass viele gemeldete Schwachstellen gar nicht exploitiert werden können. Die Forschung identifizierte wesentliche Kategorien an unnötigen Meldungen: Rund 32 % der Warnungen betreffen Probleme mit geringer Ausnutzbarkeit, etwa weil die Voraussetzung für eine Ausnutzung nicht gegeben ist.
Weitere 25 % der Schwachstellen haben keinen bekannten öffentlichen Exploit, was bedeutet, dass sie momentan von Hackern nicht aktiv genutzt werden können. Zusätzlich stammen viele der Warnungen von Komponenten, die entweder nicht mehr verwendet werden oder ausschließlich in der Entwicklungsumgebung existieren. Diese Faktoren führen zu einer Immense Menge an „Rauschen“, das Sicherheitsteams vom eigentlichen Kern der Bedrohungen ablenkt. Um dem entgegenzuwirken, wird eine neue Herangehensweise an die Applikationssicherheit dringend nötig. Anstelle einer rein detektionsbasierten Strategie ist eine evidenzbasierte Priorisierung unumgänglich.
Hierbei werden verschiedene Faktoren berücksichtigt: Ob der Code, der die Schwachstelle enthält, überhaupt genutzt wird – also seine Erreichbarkeit und Relevanz im laufenden Betrieb. Ebenso entscheidend sind Exploitierbarkeit und potenzieller Geschäftsschaden. Nicht jede Schwachstelle ist automatischer Anlass für eine Eskalation; vielmehr gilt es, ein umfassendes Verständnis der gesamten Wertschöpfungskette vom Code-Design bis in die Produktionsumgebung zu entwickeln. Innovative Technologien wie die sogenannte Code Projection von OX Security zeigen vielversprechende Ansätze, um diesen komplexen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei wird die Verbindung zwischen der Cloud-Infrastruktur, der Laufzeitumgebung und dem Quellcode hergestellt, um Kontext und Prioritäten klar zu definieren.
Dies ermöglicht eine dynamische Risikobewertung, die viel effizienter als herkömmliche statische Analysen und Scans ist. Die Anwendung solcher Methoden bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können ihre durchschnittlichen Sicherheitsalarme von über einer halben Million auf etwa 12.000 reduzieren – und davon sind nur wenige hundert wirklich kritisch und müssen sofort adressiert werden. Solch eine drastische Reduzierung der Warnmeldungen spart nicht nur erheblich Zeit und Kosten, sondern erlaubt den Sicherheits- und Entwicklungsteams auch, sich auf strategisch wichtige Aufgaben zu konzentrieren, anstatt sich in der Flut harmloser Warnungen zu verlieren.
Besonders betroffen sind Branchen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen wie der Finanzsektor, in dem besonders viele Schwachstellen gemeldet werden. Da finanzielle Transaktionen Ziel Nummer eins von Cyberangreifern sind, ist hier das Risiko von echten Angriffen besonders hoch. Dies belegt etwa der Verizon Data Breach Investigations Report, der aufzeigt, dass rund 95 % der Angreifer primär finanzielles Interesse verfolgen. Ironischerweise bedeutet dies aber auch, dass gerade hier der größte Anteil der Fehlalarme entsteht – und damit enorme Ressourcen unnötig gebunden werden. Die Konsequenzen dieser Situation sind gravierend.
Neben den verzögerten Entwicklungsprozessen und den gestressten Teams entstehen auch finanzielle Belastungen durch überflüssige Bug-Bounty-Programme und den Aufwand für die Behebung nicht kritischer Schwachstellen. Verlieren Unternehmen sich weiterhin im „Alles fixen“-Ansatz, geraten sie schnell an ihre Grenzen und erhöhen am Ende sogar das Risiko, dass echte, gefährliche Schwachstellen übersehen werden. Die Fragestellung, wie die Zukunft der Anwendungssicherheit aussehen wird, ist deshalb klar: Wichtiger als das Sammeln hunderttausender Warnmeldungen ist die gezielte Fokussierung auf das Wesentliche – die wenigen Schwachstellen, die echten Schaden anrichten können. Nur durch intelligente, auf Kontext und Risiko basierende Priorisierung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen und nicht zum Selbstzweck verkommen. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, welche Organisationen diesen Wandel erfolgreich meistern und dadurch resilienter gegen die ständig wachsenden Bedrohungen werden.
Dabei gilt es, nicht nur in bessere Technologien zu investieren, sondern auch Prozesse und Zusammenarbeit zwischen Security, Entwicklung und Business neu zu denken. Die Brücke zwischen Detektion und Priorisierung ist der Schlüssel, um Anwendungssicherheit zukunftsfähig zu gestalten und die wertvollen Ressourcen effizient zu nutzen – eine Aufgabe, an der kein Unternehmen vorbeikommt.