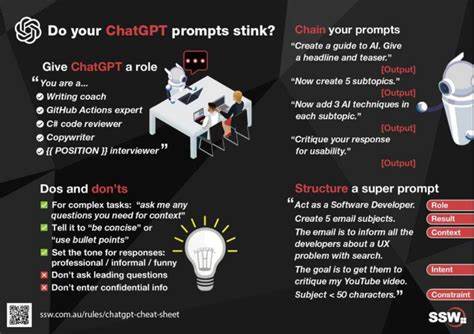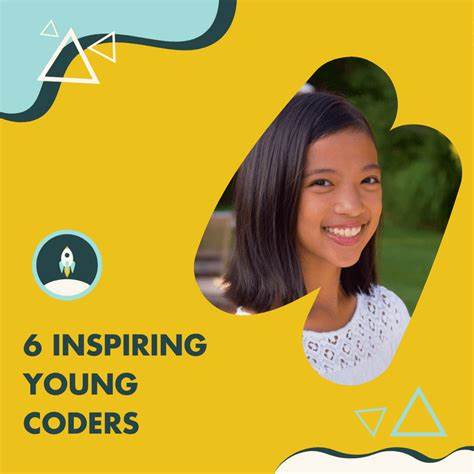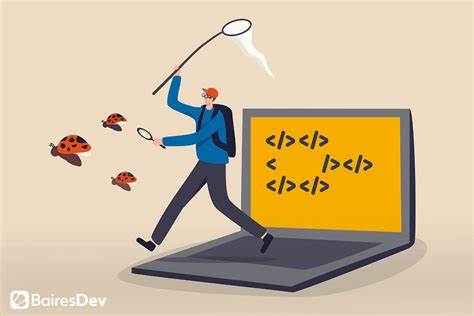In der öffentlichen Debatte über künstliche Intelligenz und insbesondere ChatGPT taucht immer wieder die Sorge auf, dass der Einsatz solcher Technologien schädlich für die Umwelt sei. Diese Befürchtung ist verständlich angesichts der globalen Herausforderungen durch den Klimawandel. Doch bei genauerer Betrachtung erweist sich die Umweltbelastung durch ChatGPT als so gering, dass sie kaum ins Gewicht fällt. Wer sich echte Wirkung im Kampf gegen den Klimawandel wünscht, sollte seine Energie statt auf die Vermeidung von ChatGPT auf deutlich wirkungsvollere Hebel konzentrieren. Der durchschnittliche Energieverbrauch pro Anfrage an ChatGPT wird von Experten auf etwa 3 Wattstunden geschätzt.
Dieser Wert mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, doch im Vergleich zu alltäglichen Aktivitäten zeigt er sich als äußerst geringfügig. Zum Beispiel entspricht diese Energiemenge der Leistung einer Glühbirne, die lediglich drei Minuten lang brennt, oder einem Laptop, der während der Nutzungszeit eines solchen Gesprächs lediglich drei Minuten läuft. Finanzielle Auswirkungen sind ebenfalls minimal: In Washington D.C. kostet der Strom für eine einzelne ChatGPT-Anfrage weniger als 0,1 Cent.
Das bedeutet, dass selbst zahlreiche Anfragen sich kaum auf die Stromrechnung auswirken. Häufig wird argumentiert, dass ChatGPT im Vergleich zu einer Google-Suche etwa zehnmal mehr Energie verbrauche. Obwohl dies eine richtige Relation ist, führt dieser Vergleich zu einer verzerrten Wahrnehmung. Google-Suchen an sich haben einen sehr niedrigen Energiebedarf, der im Alltag kaum gemessen werden kann. Wenn eine Google-Suche rund 0,3 Wattstunden benötigt, verbrauchen zehn Google-Suchen so viel Energie wie eine Anfrage bei ChatGPT.
Doch selbst dieser zehnfache Betrag ist immer noch ein winziger Bruchteil des täglichen Gesamtenergieverbrauchs einer durchschnittlichen Person und fällt in den „Rauschen“-Bereich, der von normalen Schwankungen im Verbrauch überdeckt wird. Neben dem Stromverbrauch ist auch der Wasserverbrauch ein wichtiger Umweltfaktor, der bei digitalen Dienstleistungen oft übersehen wird. In den Vereinigten Staaten beispielsweise verwendet die Stromerzeugung riesige Mengen Wasser, um Dampf für Turbinen zu erzeugen. Eine ChatGPT-Anfrage verursacht indirekt einen Wasserverbrauch von etwa 10 bis 25 Millilitern – das entspricht ungefähr dem Wasserverbrauch einer Person in wenigen Sekunden ihres Duschens. Angesichts eines täglichen Wasserverbrauchs von durchschnittlich rund 160 Litern pro Person ist auch der Wasserverbrauch durch die Nutzung von ChatGPT vernachlässigbar.
Wer also darüber nachdenkt, aus ökologischen Gründen den Einsatz von ChatGPT einzuschränken, sollte bedenken, dass das Einsparen nur weniger Sekunden Duschen viel mehr bewirken würde. Eine häufige Kritik betrifft die kollektiven Auswirkungen einer breiten Nutzung von ChatGPT. Tatsächlich nutzen inzwischen Hunderte Millionen Menschen den Dienst täglich, was global betrachtet eine nicht unbeträchtliche Energiemenge ergibt. Dennoch entspricht der gesamte Energieverbrauch von ChatGPT auf globaler Ebene in etwa dem Energiebedarf von 20.000 durchschnittlichen US-Haushalten.
Das ist zwar eine beachtliche Zahl, aber im Kontext des weltweiten Energieverbrauchs, der im Bereich von Hunderttausenden Gigawattstunden täglich liegt, verschwindet dieser Wert nahezu vollständig. Die Energie, die ChatGPT täglich benötigt, macht lediglich einen Bruchteil von 0,0006 Prozent des globalen Energiebedarfs aus. Zudem dominiert ChatGPT nur einen kleinen Teil des Gesamtenergieverbrauchs von künstlicher Intelligenz. Die meisten Ressourcen entfallen auf andere KI-Anwendungsfelder wie Empfehlungsalgorithmen in Streaming-Diensten, Unternehmensanalyse, gezielte Werbung, Computer-Vision-Anwendungen und Spracherkennungssysteme. Selbst bei weiter steigender Nutzung von ChatGPT und ähnlichen Chatbots ist daher keine massive Zunahme des Energieverbrauchs dieser speziellen Technologie zu erwarten, die allein die Umwelt maßgeblich belasten würde.
Ein oft missverstandenes Thema ist die Energie, die für das Training großer KI-Modelle benötigt wird. Das Training von GPT-4 beispielsweise verbrauchte schätzungsweise ungefähr 50 Gigawattstunden Energie. Diese Zahl erscheint enorm, muss jedoch über die Menge der damit bearbeiteten Anfragen amortisiert werden. Auf diesen Umstand bezogen belastet das Training die Umwelt pro Anfrage vergleichsweise gering. Ein Modell, das viele Milliarden Anfragen beantwortet, verteilt die anfängliche Energieinvestition auf viele Nutzer und Stunden der Nutzung.
Damit werden die Trainingskosten pro einzelne Anfrage wesentlich relativiert. Darüber hinaus ist es wichtig, nicht nur den laufenden Energieverbrauch, sondern auch die sogenannten „embodied emissions“, also die Umweltbelastung durch die Herstellung von KI-Hardware, wie Chips, in die Bewertung einzubeziehen. Schätzungen zeigen, dass diese Emissionen etwa 22 Prozent an den gesamten Emissionen eines KI-Modells ausmachen. Allerdings gilt dieses Prinzip ebenso für andere Technologien, deren Herstellung ebenfalls umweltschädlich ist. Würde man die Herstellungskosten von Chips in den ökologischen Vergleich aufnehmen, müssten vergleichbare Werte auch für alle anderen vergleiche Technologien, beispielsweise LED-Beleuchtung oder Computerhardware, berücksichtigt werden, um eine faire Beurteilung zu ermöglichen.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass die Umwelteinflüsse von ChatGPT zwar messbar sind, im Vergleich zu anderen Dingen jedoch kaum relevant für den Klimaschutz. Persönliche Verhaltensänderungen, die einen messbaren Beitrag zum Umweltschutz leisten, liegen vielfach in Bereichen wie Ernährung, Reisen oder Heizenergieverbrauch. Wer beispielsweise den Fleischkonsum reduziert oder auf klimafreundliche Verkehrsmittel umsteigt, erzielt eine deutlich größere Wirkung auf den eigenen CO2-Fußabdruck als bei jeglichem Verzicht auf ChatGPT-Einsatz. Ein verbreitetes Problem ist zudem das Gefühl von Schuld und Scham, das durch die oft übertriebene Umwelt-Diskussion um ChatGPT entstehen kann. Im Vergleich zum Stromverbrauch eines alltäglichen Lichts oder diverser kleiner elektrischer Geräte ist der Einfluss eines ChatGPT-Prompts verschwindend gering und sollte daher kein ernstzunehmender Grund für persönliche Einschränkungen sein.
Energieunternehmen und KI-Entwickler haben außerdem starke Anreize, die Effizienz zu optimieren und Ressourcenverschwendung zu vermeiden, da Energie Kosten verursacht und ineffiziente Modelle wirtschaftlich wenig sinnvoll sind. Viele Umweltbedenken gegenüber ChatGPT verwechseln zudem einzelne Indikatoren und stellen unpassende Vergleiche an. So wird gelegentlich auf die Gesamtemissionen von KI-getriebenen Datenzentren verwiesen und diese direkt mit persönlichem Konsum verglichen. Dabei muss die Gesamtemission stets kontextualisiert werden: Globaler Energiebedarf umfasst zahllose Faktoren und Tätigkeiten, die oft einen weitaus höheren CO2-Ausstoß verursachen. Die Reduktion einzelner kleinerer Aktivitäten, die ohnehin kaum messbare Auswirkungen haben, sollte nicht von den großen Herausforderungen ablenken.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Nutzung von ChatGPT aus Umweltsicht unbedenklich ist. Die grundsätzlich vorhandene Energie- und Wasserbelastung stellt keinen signifikanten Beitrag zum globalen Klimaproblem dar. Wer sich für effektiven Klimaschutz einsetzen möchte, sollte sich eher auf größere Energieverbraucher und Verhaltensänderungen mit messbarem Effekt konzentrieren. Persönlicher Verzicht auf KI-Tools wie ChatGPT ist nicht zielführend und lenkt von den wesentlichen Aufgaben ab. Die Diskussion um ChatGPT zeigt exemplarisch, wie wichtig es ist, die ökologische Bewertung neuer Technologien mit fundierten Zahlen zu führen und nicht von emotionalen oder oberflächlichen Eindrücken leiten zu lassen.
Faktenbasierte Entscheidungen helfen dabei, die Klimakrise effektiv zu bekämpfen und sich nicht in eher symbolischen Fragen zu verlieren. ChatGPT ist ein Werkzeug, dessen Umweltfußabdruck im Vergleich zu anderen Alltagsaktivitäten vernachlässigbar ist und das keinen Anlass zur Sorge gibt. Wer sich diesem Verständnis anschließt, spart nicht nur Zeit und Energie für wirklich geeignete Klimaschutzmaßnahmen, sondern kann auch die Chancen nutzen, die moderne KI der Gesellschaft bietet.