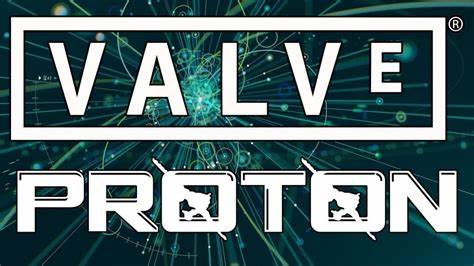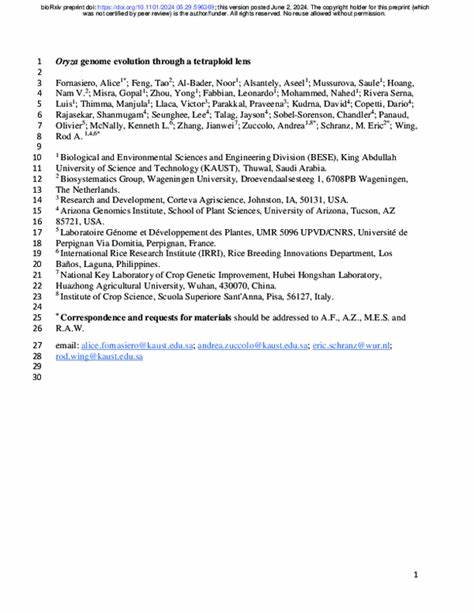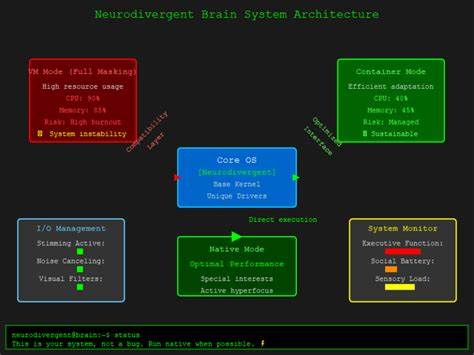Das STL-Format hat über viele Jahre hinweg die Welt des 3D-Drucks geprägt und wurde lange Zeit als Standard für die Übertragung von 3D-Modellen genutzt. Ursprünglich in den 1980er Jahren aus pragmatischen Gründen entwickelt, war STL für die damaligen Technologien ein passendes Format. Doch trotz seines historischen Erfolgs wird heutzutage immer klarer, dass das Format den Fortschritt der additiven Fertigung mehr bremst als fördert. Es ist an der Zeit, sich von STL zu verabschieden und auf fortschrittlichere, effizientere Alternativen umzusteigen, die den Anforderungen moderner Produktionsprozesse gerecht werden. Die Ursprünge von STL sind eng mit der Entstehung der ersten 3D-Drucktechnologien verbunden.
Charles Hull, einer der Pioniere des 3D-Drucks, suchte nach einem einfachen und leicht umsetzbaren Format für den Datentransfer zwischen CAD-Systemen und den frühen 3D-Druckmaschinen. STL, ein Akronym, das ursprünglich von Stereolithografie stammte, entstand als eine Sammlung von Dreiecksmustern, welche die Oberflächen von Objekten approximieren sollten. Dieses Konzept setzte auf eine simple, polygonale Darstellung, bei der komplexe CAD-Geometrien auf Dreiecke heruntergebrochen wurden. Zum damaligen Zeitpunkt war diese Methode aufgrund der begrenzten Rechnerleistung sinnvoll. Mit seiner Einfachheit brachte STL jedoch auch erhebliche Einschränkungen mit sich.
So erlaubt das Format nur eine reine Oberflächendarstellung über Dreiecke, wodurch weder Volumendaten noch parametrische Informationen oder Designhistorien gespeichert werden können. Ein OBJ, 3MF oder insbesondere native CAD-Formate erlauben hingegen eine reichhaltigere Informationsbasis, inklusive Farben, Materialeigenschaften oder Verschachtelungen. Die Beschränkung auf Dreiecke bedeutet außerdem eine Abstraktion der ursprünglichen Geometrie mit nicht exakt darstellbaren Kurven und Flächen, was die Präzision und Qualität der gedruckten Objekte beeinflusst. Das STL-Format bringt zudem technische Herausforderungen mit sich. Da es ausschließlich Flächeninformationen nutzt, können bereits kleine Fehler große Auswirkungen haben.
Beispielsweise können umgekehrte Normalen, überlappende oder fehlende Dreiecke Druckfehler verursachen oder die Software zum Absturz bringen. Vor jedem Druck muss eine Datei daher gründlich geprüft und oft repariert werden, was Zeit und spezialisierte Software erfordert. Dies ist ein unnötiger Mehraufwand in einem Prozess, der eigentlich auf Effizienz zielt. Darüber hinaus führt die Triangulation großer, komplexer Modelle zu sehr hohen Dateigrößen. Millionen von Dreiecken können entstehen, die nicht nur mehr Speicherplatz verbrauchen, sondern auch Slicer-Programme erheblich verlangsamen oder überlasten.
Dies kann die Produktivität in industriellen Fertigungsprozessen entscheidend beeinträchtigen und den Fortschritt behindern. Die Weiterentwicklung des 3D-Drucks hat gezeigt, dass die Zukunft in der direkten Nutzung nativer CAD-Dateien liegt. Im Gegensatz zu STL speichern diese Formate nicht einfach eine statische Oberfläche, sondern bewahren parametrische Daten, Konstruktionslogiken, Constraints und die gesamte Designhistorie. Das bedeutet, dass Änderungen am Modell schnell und intelligent vorgenommen werden können, ohne von vorne beginnen zu müssen. Dies sorgt für Flexibilität und Geschwindigkeit im Designprozess.
Moderne CAD-Formate ermöglichen weiterhin eine absolut präzise Darstellung der Geometrie. Da kein Triangulieren erforderlich ist, bleiben Kurven, Flächen und Details erhalten, was sich in einer höheren Oberflächenqualität und damit in besseren Endprodukten widerspiegelt. Ebenso bieten sie eine wesentlich kleinere Dateigröße – selbst bei komplexen Objekten. Dies schafft Raum für automatisierte Workflows, beispielsweise durch Parametersteuerung, die das manuelle Nachbearbeiten von Dateien nahezu überflüssig machen können. Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Integration zusätzlicher Informationen.
Native CAD-Dateien können Meta-Daten wie Farbe, Materialzuordnungen oder Baubereiche enthalten. Diese Informationen können automatisierte Prozessschritte in der additiven Fertigung steuern, etwa unterschiedliche Druckparameter für verschiedene Regionen eines Bauteils oder gezieltes Einfügen von Stützstrukturen. Somit wird die Prozesssicherheit erhöht, Fehler werden reduziert und die Reproduzierbarkeit wird zuverlässig gewährleistet. Bereits heute sind zahlreiche Lösungen auf dem Markt, die auf eine solche CAD-basierte Fertigung setzen. Große Unternehmen aus der Industrie, wie Stratasys oder Dyndrite, bieten Software an, die direkt native CAD-Modelle nutzen und dadurch vieles einfacher und effizienter gestalten.
Selbst 3MF, das als moderneres Format gegenüber STL gilt, kann nicht alle Probleme lösen, denn es basiert immer noch auf Dreiecksmessdaten – wenn auch mit zusätzlichen Funktionen. Ein Vergleich verdeutlicht die Unzeitgemäßheit von STL besonders eindrucksvoll: Wir nutzen auch heute keine Bitmap-Bilder mehr, um Dokumente zu speichern, zu bearbeiten und zu drucken. Stattdessen bleiben Textinformationen in editierbaren, intelligenteren Formaten erhalten, um maximale Flexibilität und Qualität zu gewährleisten. Trotzdem beharrt die additive Fertigung in manchen Bereichen noch auf veralteten Datenformaten, was Prozesse unnötig erschwert. Insgesamt gilt: Die Industrie sollte den Weg komplett in Richtung nativer CAD-basierten Workflows gehen.
Das bedeutet, dass statt STL-Exporte reine CAD-Dateien vom Entwurf bis zum Druck verwendet werden. Nur so lassen sich die Verfahren beschleunigen, Kosten senken, Fehler minimieren und das volle Potenzial der additiven Fertigung ausschöpfen. Zwar bedeutet dies eine Herausforderung für Softwarehersteller, die Slicing-Programme und Maschinensteuerungen so anpassen müssen, dass sie mit nativen CAD-Daten umgehen können. Doch gerade in Zeiten steigender Anforderungen an Fertigungsgeschwindigkeit und Produktqualität ist dies unumgänglich. Die Umstellung fordert auch ein Umdenken bei Unternehmen, die auf alte Tools und bewährte Workflows setzen.
Die Vorteile überwiegen jedoch deutlich: Schnellere Entwicklungszyklen, reduzierter Ressourcenverbrauch, verbesserte Produktqualität und eine deutlich automatisiertere Prozesskette. Dies macht Unternehmen wettbewerbsfähiger und innovativer – besonders in einem Markt, der sich so rasant weiterentwickelt wie die additive Fertigung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das STL-Format seine Rolle als Pionier gespielt hat und auf seiner Zeit basierte. Die additive Fertigung der Zukunft benötigt allerdings intelligente, flexible und präzise Datenformate, die nicht nur dreidimensionale Oberflächen, sondern vollständige Bauteilinformationen übermitteln. Native CAD-Dateien bieten genau diese Möglichkeiten, wodurch STL im industriellen Kontext zunehmend obsolet wird.
Unternehmen und Entwickler sind daher aufgefordert, diesen Wandel aktiv zu gestalten, um die Chancen des 3D-Drucks voll auszuschöpfen.