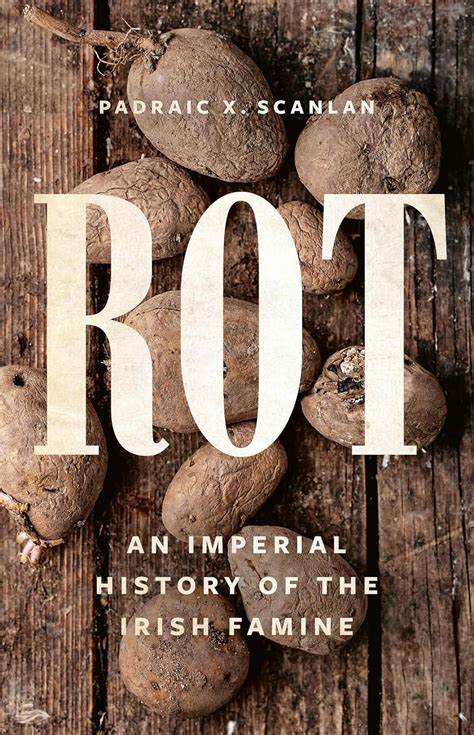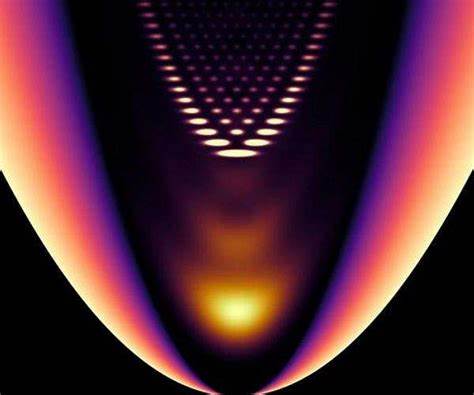Die große irische Hungersnot, ein verheerendes Ereignis, das Irland zwischen 1845 und 1852 erschütterte, gilt als eine der tragischsten Katastrophen der europäischen Geschichte. Das Buch Rot: A History of the Irish Famine von Padraic X. Scanlan bietet eine tiefgreifende Untersuchung jener Zeit und verbindet den Ausbruch und die Folgen der Hungersnot mit den politischen und wirtschaftlichen Strukturen des britischen Kolonialsystems und Kapitalismus. Es ist ein Werk, das weit über einfache Erklärungen hinausgeht und die Verflechtungen von Ideologie, Wirtschaft und Politik analysiert, die zur Tragödie führten. Zentral in Scanlans Analyse steht die These, dass die Hungersnot nicht einfach eine Naturkatastrophe war, sondern das Ergebnis einer langwirkenden strukturellen Ausbeutung, die das irische Volk verwundbar machte.
Der sogenannte Kartoffelfäule-Erreger, der die Hauptnahrungsquelle vieler irischer Bauern zerstörte, löste die Katastrophe aus. Doch die Ursache liegt tiefer: Die jahrhundertelange ökonomische Abhängigkeit Irlands von Großbritannien, die Landenteignungen und die verzerrte Agrarstruktur, in der irische Bauern hauptsächlich von Kartoffelanbau lebten, sind maßgeblich zu betrachten. Besonders eindrücklich schildert Scanlan, wie Irlands scheinbar rückständige Landwirtschaft durch die profitorientierten Forderungen der britischen Industrie und Märkte bestimmt war. Während Irland auf die Kartoffel als Hauptnahrungsmittel setzte, wurden seine landwirtschaftlichen Ressourcen zunehmend auf die Produktion von Getreide und Vieh ausgerichtet, um den Hunger britischer Städte zu stillen. Die Irische Bevölkerung lebte somit paradoxerweise in einer Zeit großer wirtschaftlicher Aktivität und Preisgestaltung auf dem Weltmarkt, aber der Großteil hatte keinen Zugang zu den eigenen Erzeugnissen und hing von einer einzigen Kulturpflanze ab.
Ein zentrales Element in Scanlans Werk ist die ideologische Rechtfertigung der britischen Politik durch die Verbreitung von Stereotypen und rassistischen Vorstellungen gegenüber den Iren. Begriffe wie „potatophagi“, was so viel heißt wie Kartoffelesser, zeigen eine abwertende Haltung gegenüber den irischen Bauern, die in britischen Medien oft als faul und rückständig dargestellt wurden. Diese negative Wahrnehmung führte dazu, dass die britische Regierung die Hungersnot nicht als humanitäre Krise verstand, sondern als eine Folge der angeblichen Unfähigkeit und moralischen Schwäche der irischen Bevölkerung. Dieses Bild beeinflusste entscheidend die Art und Weise, wie die britische Regierung auf die Katastrophe reagierte. Die damals vorherrschende Wirtschaftspolitik lehnte großzügige Soforthilfen ab und bestand stattdessen darauf, dass der Markt seine eigenen Gesetze beibehalten müsse.
Scanlan erläutert, wie britische Politiker darauf setzten, dass freie Handelsprinzipien und marktwirtschaftliche Kräfte allein zum Ende der Krise beitragen würden. So wurde die Einfuhr von amerikanischem Mais zwar genehmigt, doch dies diente teilweise auch dazu, neue Absatzmärkte für britisches Getreide zu erschließen und nicht primär zur Rettung der irischen Bevölkerung. Öffentliche Programme wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurden zwar eingeführt, konnten aber den massenhaften Hunger und das Elend kaum lindern. Der Autor zeigt auf, dass die Verflechtung von Politökonomie und kolonialen Ideologien in der britischen Verwaltung die Handlungsspielräume stark einschränkte und oftmals sogar aktiv das Leid der Menschen verlängerte. Zudem hebt Scanlan hervor, dass politische Karrieren und die öffentliche Meinung in Großbritannien nicht selten auf der Festigung von Vorstellungen von Überlegenheit gegenüber Irland beruhten und dass politische Parteien über ihre ideologischen Grenzen hinweg ähnliche verhängnisvolle Entscheidungen trafen.
Dieses gemeinsame politische Material war geprägt von einer Geringschätzung gegenüber irischem Leiden und einer Fokussierung auf „disziplinierende“ Konzepte wie den Glauben an Arbeitszwang und den freien Markt. Ein weiterer Aspekt, den das Buch eingehend behandelt, ist die Rolle der Sozialgesetze, insbesondere des Armenrechts, das 1838 in Irland eingeführt wurde und eine entscheidende Wirkung während der Hungersnot hatte. Diese Gesetze zwangen verarmte Menschen, Zuflucht in oft brutalen Arbeitshäusern zu suchen, deren Bedingungen grausam waren. Die strenge und effizienzgetriebene Verwaltung solcher Einrichtungen spiegelte die britische Haltung gegenüber Armut und Bedürftigkeit wider und trug damit zur tiefen Entrechtung und zum Leid großer Bevölkerungsgruppen bei. In der historischen Forschung gibt es einen langen Diskurs darüber, in welchem Maße Irland als Kolonie betrachtet werden kann und wie koloniale Strategien die wirtschaftliche und soziale Entwicklung hemmten oder beeinflussten.
Scanlans Werk stellt die Kolonialisierung als zentralen Faktor heraus, weist aber auch auf die Komplexität hin, indem er die Rolle der irischen Gesellschaft selbst beleuchtet, die nicht nur Opfer war, sondern auch eigenständige Akteure im historischen Prozess. Allerdings kritisieren manche Historiker, dass Scanlans Fokus mehr auf den Opfern und der britischen Schuld liegt und dadurch die Ambivalenzen und Widersprüche innerhalb der irischen Geschichte und Gesellschaft zu kurz kommen. Insgesamt bietet Rot: A History of the Irish Famine eine kraftvolle und packende Erzählung, die das Verständnis der großen Hungersnot durch die Linse des kapitalistischen Systems und der kolonialen Machtmechanismen neu interpretiert. Das Buch ist sowohl für Fachleute als auch für die breite Leserschaft geeignet, die sich für die Geschichte Irlands interessieren und die weitreichenden Folgen der Hungersnot nachvollziehen möchten. Es verdeutlicht, wie wirtschaftliche Interessen und politische Ideologien ein humanitäres Desaster herbeiführen können, wenn sie über das Wohl einer ganzen Bevölkerung gestellt werden.