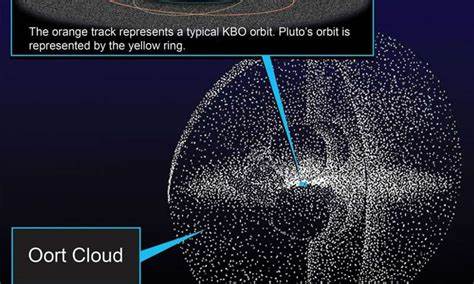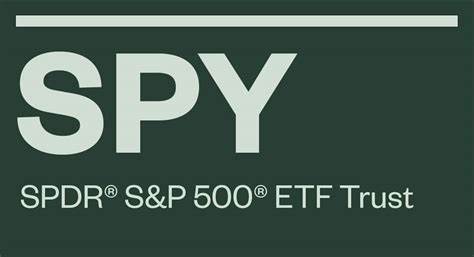Bitcoin und andere Kryptowährungen haben sich längst als feste Größe im Finanzsystem etabliert und sind zunehmend auch im Fokus staatlicher Behörden, nicht zuletzt wegen ihrer Nutzung in illegalen Aktivitäten. Die USA gehören zu den Ländern, in denen die Menge an beschlagnahmten Bitcoins durch Strafverfolgungsmaßnahmen und zivile Verfahren stetig wächst. Dadurch stellt sich eine wichtige Frage: Kann die US-Regierung diese Bitcoins selbst nutzen, oder beschränkt sich ihr Handlungsspielraum ausschließlich auf die Liquidation? Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur juristisch, sondern auch ethisch und praktisch komplex. Um diese zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die rechtlichen Grundlagen, die Herausforderungen beim Umgang sowie die globalen Vergleiche im Hinblick auf den Umgang mit beschlagnahmten Kryptowerten. Die Beschlagnahmung von Bitcoin in den USA erfolgt hauptsächlich im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen.
Hier kommen in erster Linie bundesrechtliche Vorschriften zum Einsatz, etwa das Money Laundering Control Act aus dem Jahr 1986, das Comprehensive Crime Control Act von 1984 und die Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) von 2000. Wichtig ist der Unterschied zwischen strafrechtlicher und zivilrechtlicher Beschlagnahme. Erstere setzt eine Verurteilung voraus, während Letztere bereits bei wahrscheinlichem Bezug zur Straftat greifen kann, was besonders bei Bitcoin aufgrund seiner Rückverfolgbarkeit über die Blockchain-Technologie eine Rolle spielt. Zahlreiche Bundesbehörden sind an der Einziehung und Verwaltung von beschlagnahmten Kryptowährungen beteiligt. Das Justizministerium (DOJ) führt die Untersuchungen und Anklagen in Fällen von Kryptowährungsdelikten.
Die US-Marshals Service (USMS) übernimmt die Verwahrung und Verwertung der beschlagnahmten Bitcoins, während FBI, IRS und Homeland Security Investigations (HSI) oft bei der Aufdeckung und Analyse von illegalen Aktivitäten mithilfe von Blockchain-Forensik mitwirken. Ein bekanntes Beispiel für die erfolgreiche Beschlagnahme ist die Sicherstellung von rund 69.000 Bitcoin aus dem Schwarzmarkt Silk Road, deren Werte inzwischen im Milliardenbereich liegen. Diese Fälle verdeutlichen den hohen Aufwand, der erforderlich ist, um pseudonyme Transaktionen nachzuverfolgen und Beteiligte zu identifizieren. Der Umgang mit beschlagnahmten Bitcoin gestaltet sich jedoch schwierig.
Im Gegensatz zu traditionellen Vermögenswerten erfordert die sichere Verwaltung von Kryptowährungen spezielle technische Kenntnisse. Private Schlüssel müssen vor Cyberangriffen geschützt werden, da ein Verlust oder Diebstahl zu irreversiblen Schäden führen kann. Zudem sind die Kurse von Bitcoin sehr volatil, wodurch eine langfristige Aufbewahrung risikobehaftet ist. Dies hat zur Folge, dass die Regierung sich in der Praxis vorwiegend auf die Versteigerung der Kryptowährungen konzentriert, um so schnell liquide Mittel in US-Dollar zu generieren, die dann öffentlichen Fonds zugutekommen. Auf rechtlicher Ebene verbietet es die US-Gesetzgebung derzeit der Regierung, beschlagnahmte Bitcoin direkt für operative Zwecke oder als Reservevermögen zu nutzen.
Die eingeführten Regularien sehen vor, dass solche Vermögenswerte meist zu Geld gemacht und der Allgemeinheit zugutegefügt werden müssen. Eine längerfristige Haltung von Bitcoin als staatlicher Vermögenswert könnte eine neue Ära einleiten und weltweit Vorbildcharakter haben, birgt jedoch erhebliche Risiken. Beispielsweise könnten Kursschwankungen das Vertrauen der Öffentlichkeit in staatliche Finanzpolitik untergraben und zu Instabilitäten am Markt führen. Marktliche Auswirkungen sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Große Bitcoin-Auktionen der US-Marshals, wie die damals nach der Silk Road-Ermittlung, beeinflussen die Angebot-Nachfrage-Dynamik und können kurzfristige Preisschwankungen hervorrufen.
Es wird befürchtet, dass der Staat unbeabsichtigt als Marktakteur wahrgenommen wird, was Anreize für Marktmanipulationen schaffen könnte – etwas, was die USA unbedingt vermeiden wollen. Internationale Erfahrungen zeigen unterschiedliche Ansätze beim Umgang mit beschlagnahmten Kryptowährungen. Im Vereinigten Königreich etwa werden beschlagnahmte Crypto-Assets meist schnell verkauft, die Erlöse dienen der Unterstützung von Ermittlungsbehörden. Kanada verfolgt ähnliche Praktiken, wobei Auktionen genutzt werden, um die Gelder in gerichtliche Restitutionsfonds einzuzahlen. Deutschland hingegen verdeutlicht die Herausforderungen hinsichtlich der zugänglichen Schlüssel, da oft die sogenannten privaten Schlüssel fehlen, was eine effektive Kontrolle erschwert.
Australien wiederum setzt auf zügige Liquidationen, um Erlöse in den föderalen Haushalt zu übertragen. Besonders interessant sind auch diskutierte politische Vorschläge in den USA, wie jene des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der anregte, einen Prozentsatz der beschlagnahmten Bitcoin zu behalten, um öffentliche Programme zu finanzieren oder gar als strategische Reserve anzulegen. Diese Ideen treffen auf Zustimmung und Kritik. Befürworter sehen darin eine Möglichkeit, die Diversifikation der Staatsreserven zu verbessern und Inflation abzufedern. Gegner warnen vor einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der USA, da Ratingagenturen die hohe Volatilität und Spekulation des Bitcoin als Risiko einstufen könnten.
Die Frage, ob Bitcoin tatsächlich als Reservevermögen taugt, ist umstritten. Einerseits besitzt Bitcoin eine weltweit bedeutende Liquidität sowie eine dezentrale, zensurresistente Struktur, was es theoretisch zu einem Schutz vor politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten macht. Andererseits ist das Asset erheblichen Schwankungen bei Preis und Technologie ausgesetzt und bedarf spezieller Sicherheitsmaßnahmen, die digitale Risiken erhöhen. Schlussendlich steht die US-Regierung vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Vorsicht zu finden. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen fokussieren sich klar auf die Liquidation, um Transparenz zu gewährleisten und öffentliche Interessen zu schützen.