Vitalik Buterin, die treibende Kraft hinter Ethereum, hat sich eine klare Vision gesetzt: Bis zum Jahr 2030 soll Ethereum so einfach und robust sein wie Bitcoin. Dieses Ziel formulierte er in einem Blogpost Anfang Mai 2025 und hinterlässt damit eine deutliche Botschaft an die Entwicklergemeinschaft und die gesamte Blockchain-Branche. Was steckt hinter diesem Vorhaben, und welche Veränderungen sind notwendig, um eine solch grundlegende Vereinfachung zu erreichen? Die Antwort darauf beruht auf einer Analyse der aktuellen technischen Herausforderungen von Ethereum sowie strategischen Modernisierungen, die sowohl die Skalierbarkeit verbessern als auch die Systemarchitektur entschlacken sollen. Ethereum gilt seit seiner Einführung als Innovationsmotor der Blockchain-Technologie – dank seiner Smart-Contract-Funktionalitäten und der Möglichkeit, dezentrale Anwendungen (DApps) zu realisieren. Allerdings bringt die komplexe Struktur des Netzwerks auch eine Vielzahl von Problemen mit sich, darunter hohe Entwicklungs- und Wartungskosten, Sicherheitsrisiken und Skalierungsengpässe.
Buterin reflektiert offen, dass ein Großteil dieser Komplexität auf historische Entscheidungen zurückzuführen ist, die Ethereum zwar leistungsfähig, jedoch schwerfällig und kostenintensiv gemacht haben. Sein Vorschlag zielt darauf ab, die wesentlichen Bestandteile von Ethereum so zu vereinfachen, dass der gesamte Konsensmechanismus und die Ausführungsschicht schlanker, verständlicher und nachhaltiger werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist die Vereinfachung des Konsens-Layers, wo Ethereum derzeit auf komplizierte Mechanismen wie Slots, Epochen und Sync-Kommittees setzt. In Zusammenarbeit mit Forschern der Ethereum Foundation hat Justin Drake bereits im November 2024 eine Weiterentwicklung vorgeschlagen, das sogenannte Beam Chain Upgrade, welches Buterin als zukunftsträchtig einstuft. Dieses Upgrade verspricht die Einführung eines neuartigen 3-Slot-Finality-Mechanismus, der weit weniger kompliziert ist und in wenigen hundert Zeilen Code realisiert werden kann.
Das Ziel dahinter ist nicht nur eine verbesserte Verständlichkeit, sondern auch eine Reduktion der Angriffsflächen und Vereinfachung der Protokoll-Implementierungen. Durch die Verringerung der aktiven Validatoren und die Einführung von STARK-basierten Aggregationsprotokollen wird zudem eine robustere Peer-to-Peer-Architektur möglich, was die Sicherheit und Effizienz erhöht. Die Ausführungsebene von Ethereum soll ebenfalls umfassend modernisiert werden. Buterin schlägt vor, die bisherige Ethereum Virtual Machine (EVM) durch eine einfachere, effizientere Architektur basierend auf RISC-V zu ersetzen. RISC-V ist eine offene Hardware-Architektur, die für ihre Klarheit und Effizienz bekannt ist.
Eine Einführung von RISC-V könnte die Geschwindigkeit von Smart-Contract-Ausführungen um das Hundertfache steigern und gleichzeitig die Komplexität reduzieren. Dabei ist es essenziell, dass die Abwärtskompatibilität mit bestehenden Anwendungen gewahrt wird. Dies könnte durch sogenannte „Übersetzungsschichten“ realisiert werden, ähnlich wie bei anderen Betriebssystemen oder Softwareplattformen, die langfristige Kompatibilität trotz fundamentaler Updates sicherstellen. Buterin verdeutlicht, dass nicht alle komplexen Elemente vollständig entfernt, sondern vielmehr aus dem konsenskritischen Bereich ausgelagert werden sollen. Somit bleibt die Kernlogik schlank, während zusätzliche, komplexe Funktionen in separaten, optionalen Modulen gehandhabt werden können.
Dieses Konzept vermindert systemische Risiken und sorgt dafür, dass Fehler außerhalb der kritischen Pfade keine katastrophalen Auswirkungen auf das Netzwerk haben. Das entspricht einer Philosophie, die eher auf „verkapselte Komplexität“ statt auf ausufernde, schwer wartbare Systeme setzt. Darüber hinaus ist das Ziel, Ethereum-Protokolle mit einheitlichen Standards zu versehen. Buterin schlägt vor, eine gemeinsame Codierung für Data Availability Sampling, Peer-to-Peer-Verbindungen und verteilte Speicherung zu verwenden. Ein einheitliches Serialisierungsformat, beispielsweise mittels SSZ (SimpleSerialize), kann somit über alle Schichten hinweg zur Anwendung kommen.
Diese Harmonisierung führt zu einer schlankeren Codebasis, geringeren Fehleranfälligkeit und verbesserter Verifizierbarkeit. Langfristig könnte Ethereum für Konsens und Ausführung von der derzeit genutzten hexary Merkle Patricia Tree-Struktur zu einer binären Baumstruktur wechseln, was weitere Effizienzgewinne und Komplexitätsreduktionen verspricht. Neben den technischen Aspekten spricht Buterin auch von einem kulturellen Wandel innerhalb der Ethereum-Community. Es gilt, eine bewusste Entscheidung für Einfachheit als Priorität zu treffen und eine Entwicklungsmentalität zu fördern, die komplexe Systeme hinterfragt und stets nach pragmatischen Vereinfachungen sucht. Ein Inspiration dafür ist das Projekt Tinygrad, das sich durch eine explizite Begrenzung der maximalen Codezeilen auszeichnet und damit bewusst auf einfache, nachvollziehbare Software setzt.
Buterin betont, dass diese Maxime auf alle Bereiche angewandt werden soll, insbesondere auf konsenskritische Codes, die langfristig Bestand haben müssen. Was bedeutet das für die Zukunft von Ethereum und der Blockchain-Technologie allgemein? Die Vereinfachung von Ethereum könnte dessen Akzeptanz und Nutzbarkeit erheblich steigern. Ein einfacheres Protokoll senkt die Einstiegshürden für Entwickler, verringert die Kosten für Infrastrukturanbieter und reduziert die Risiken von Sicherheitslücken. Zugleich bietet die angestrebte Architektur die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit durch modernste Kryptographie und effiziente Protokolle zu steigern. Durch die parallele Beibehaltung von Rückwärtskompatibilität können bestehende Anwendungen weiterhin problemlos betrieben werden, während sich das Netzwerk modernisiert.
Die Vision von Vitalik Buterin ist ein bedeutender Schritt hin zu nachhaltigen Blockchain-Systemen, die auch in den kommenden Jahrzehnten wettbewerbsfähig und sicher bleiben. Im Vergleich zu Bitcoin, das aufgrund seines minimalistischen Designs bekannt ist, wird Ethereum künftig ähnlich schlank und übersichtlich funktionieren – jedoch mit einer deutlich erweiterten Funktionalität als multifunktionale Plattform für dezentrale Anwendungen. Diese Kombination aus Einfachheit und Vielseitigkeit könnte Ethereum als führende Infrastruktur im Web3 weiter festigen. In der Zwischenzeit bleibt es spannend zu beobachten, wie Entwickler und Forscher die vorgeschlagenen Änderungen umsetzen und wie sich das Ökosystem auf diesem Transformationsweg entwickelt. Das Ziel, Ethereum bis 2030 so einfach wie Bitcoin zu machen, stellt eine Herausforderung dar, die technische Innovation, Gemeinschaftsgeist und strategische Weitsicht erfordert.
Doch wenn diese Vision gelingt, könnte die Blockchain-Branche einen bedeutenden Fortschritt in Sachen Skalierbarkeit, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit feiern – mit positiven Auswirkungen weit über den Kryptomarkt hinaus.



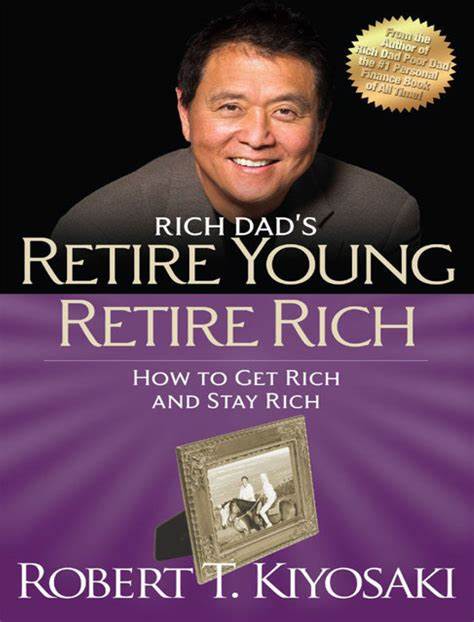

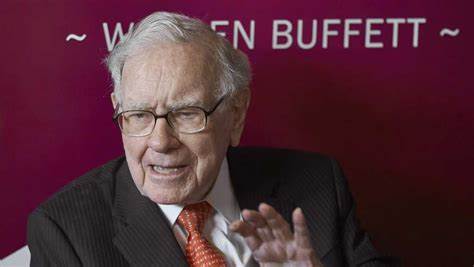


![The Science of "Muddling Through" (1959) [pdf]](/images/5DFF0CD0-9E58-4454-8478-6460C5F6CCD4)
