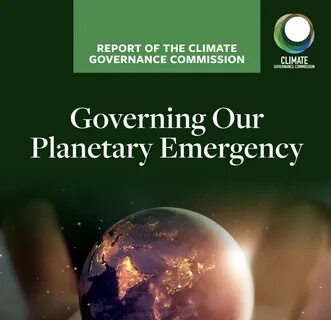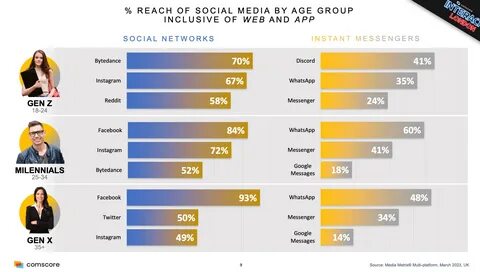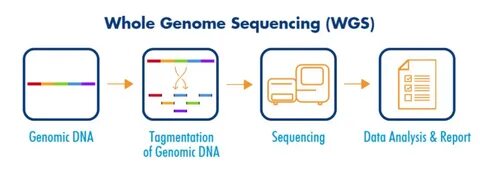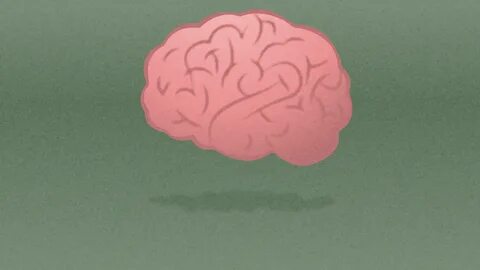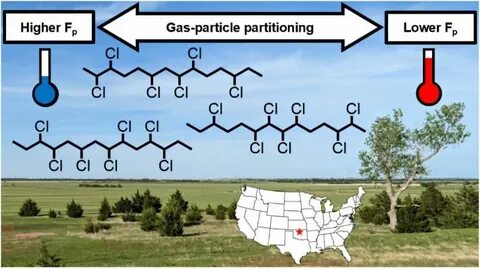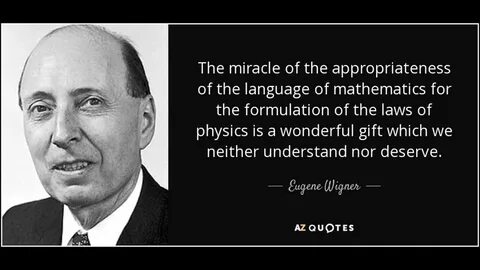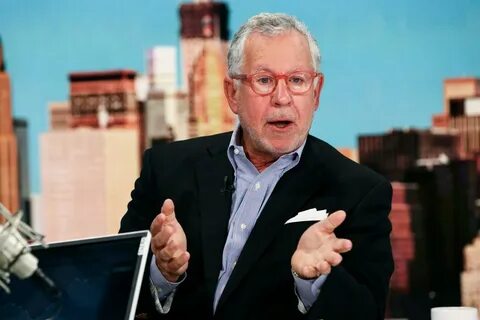Die Idee einer planetaren Regierungsführung, die globale Herausforderungen überstaatlich und zentral koordiniert, gewinnt in Zeiten von Umweltkrisen, wirtschaftlicher Globalisierung und internationaler Unsicherheit zunehmend an Aufmerksamkeit. Doch trotz dieser Attraktivität gibt es bedeutende Einwände dagegen, die vor allem die Gefahren einer Entmachtung nationaler Demokratien, die Komplexität globaler Steuerung und das wachsende Spannungsverhältnis zwischen globaler Technokratie und individueller Selbstbestimmung betonen. Wolfgang Streeck, ein prominenter deutscher Soziologe und ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts, legt in seinem Werk eine fundierte Kritik an der planetaren Regierungsführung dar und plädiert stattdessen für die Wiedererlangung der souveränen Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten als Kern demokratischer Ordnung. Die Debatte, die er anstößt, ist von großer Relevanz für jene, die sich mit der Zukunft von Demokratie und Politik in einer zunehmend vernetzten Welt auseinandersetzen. Im Kern argumentiert Streeck, dass demokratische Systeme untrennbar mit funktionierender staatlicher Souveränität verbunden sind.
Ohne diese souveräne Autorität über ein geografisch definiertes Territorium – wie sie nur der Nationalstaat gewährleistet – könne keine verlässliche demokratische Kontrolle ausgeübt werden. Damit greift er eine wichtige Kritik an transnationalen Institutionen, internationalen Gerichtshöfen und weltweiten Handelsabkommen auf, die nationale Parlamente und Regierungen zunehmend entmachten und technokratischen Entscheidungsprozessen unterwerfen. Diese Entwicklung beschreibt er als stillen Verlust fiskalischer und politischer Hoheit, der seit den 1970er-Jahren voranschreitet und mit dem Siegeszug neoliberaler Wirtschaftsordnungen eng verbunden ist. Der Prozess der Übertragung von Kompetenz auf multilaterale Mechanismen hat einen vermeintlichen Nutzen: die wirtschaftliche Vereinheitlichung und einen reibungslosen globalen Handel zu fördern. Doch Streeck zeigt auf, dass diese Vereinheitlichung nicht nur die handlungsfähigen demokratischen Strukturen unterminiert, sondern auch die gesellschaftliche Vielfalt und das einzigartige „kollektive Partikularismus“ der einzelnen Gesellschaften ignoriert.
Dabei handelt es sich um die Fähigkeit von Gemeinschaften, ihre spezifischen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten auszudrücken und in Politik umzusetzen. Wenn ein wirtschaftliches Regime ohne Rücksicht auf diese Differenzen übergestülpt wird, wächst nicht nur die politische Unzufriedenheit, sondern auch das Terrain für autoritäre Bewegungen und reaktionäre Rhetoriken. Streecks Perspektive ist tief in der historischen und theoretischen Analyse verankert, insbesondere orientiert sich sein Ansatz an den Gedanken von John Maynard Keynes und Karl Polanyi. Beide Denker plädierten für ein Modell, das wirtschaftliche Steuerung und demokratische Kontrolle im Rahmen souveräner Nationalstaaten kombiniert. Keynes, insbesondere in seiner Rede von 1933 an der Yale University, äußerte sich skeptisch gegenüber ungezügeltem Freihandel und sprach sich für nationale ökonomische Regulierung aus, um soziale Stabilität und demokratische Partizipation zu gewährleisten.
Polanyi wiederum betonte, dass ohne Kontrolle der eigenen Währung und der internationalen Wirtschaftsbeziehungen die nationalen Gesellschaften dem „Markt“ schutzlos ausgeliefert seien, was soziale Unruhen und politische Radikalisierung begünstige. Diese zentrale Rolle des Nationalstaats als Wirtschaftsakteur und demokratische Institution bildet den Kern von Streecks Konzept des „Keynes-Polanyi-Staates“. Er sieht darin eine Antwort auf die Herausforderungen, die sich aus einem zunehmend komplexen globalen Wirtschaftssystem ergeben, das demokratisch nicht bewältigt werden kann, wenn Verantwortung an anonyme internationale Netzwerke und Institutionen delegiert wird. Souveräne Nationalstaaten wiederum sollen durch Dezentralisierung und die Rückgewinnung von Kontrollrechten in der Lage sein, ökonomische Interessen stabil mit demokratischen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Gleichzeitig sieht Streeck die Gefahr, dass große Staaten und Wirtschaftsakteure durch zentralisierte Planung oder durch das Fehlen solcher Planung in Krisen geraten.
Innerhalb großer Staaten komme es zu einem Dilemma: Zu viel zentrale Planung führe zu Ineffizienz und Demokratieverlust, zu wenig Planung führe zu Markversagen und sozialer Instabilität. Dezentralisierung, im Sinne eines Subsidiaritätsprinzips, könnte hier Abhilfe schaffen, indem regionale und lokale Einheiten gestärkt werden, sodass sie spezifischen Problemlagen besser gerecht werden können. Dieses Prinzip der Dezentralisierung soll auch für internationale Beziehungen gelten, wo ein Netzwerk souveräner, kleinerer Staaten eine multipolare Welt ohne hegemoniale Strukturen ermöglichen kann. In Bezug auf große Multi-Staaten-Konstellationen oder Länder ohne Tradition kleiner territorialer Gemeinschaften weist Streeck darauf hin, dass ein einfacher Zerfall großer Staaten keine Lösung sei. Der Aufruf zur Dezentralisierung ist ein durchaus vorsichtiger und pragmatischer Vorschlag, der nicht auf Sezession, sondern auf kooperative Autonomie zielt.
Dabei ist ein internationaler friedensstiftender Rahmen unverzichtbar, damit kleinere Staaten ihre Souveränität wahren und gegenseitig respektieren können. Historisch verweist er auf Bewegungen wie die der Blockfreien und aktuelle Entwicklungen innerhalb der BRICS-Staaten, die auf eine multipolare internationale Ordnung hinarbeiten. Die globale Herausforderung besteht also nicht darin, eine alles umfassende planetare Regierungsstruktur zu errichten, die Entscheidungen auf höchster Ebene durchsetzt. Vielmehr müsse der Fokus auf Demokratisierung, besserer regionaler Governance und der Stärkung von Staaten liegen, die in der Lage sind, souverän und responsiv auf ihre Bevölkerungen zu reagieren. Der technokratische Traum von einer homogenen globalen Wirtschafts- und Verwaltungseinheit übersieht die komplexen sozialen Realitäten und demokratischen Bedürfnisse der Menschen vor Ort.
Zudem stellt sich die Frage, inwiefern technologische Innovationen – besonders im Bereich der digitalen Vernetzung und künstlichen Intelligenz – die demokratische Kontrolle von Staaten verbessern können. Streeck bleibt hier skeptisch und hebt hervor, dass Technologie erst dann einen positiven Beitrag leisten könne, wenn sie staatliche Institutionen tatsächlich ermächtigt und die breite gesellschaftliche Teilhabe fördert. In vielen Fällen verstärken digitale Netzwerke jedoch die Macht privater Hierarchien und untergraben demokratische Einflussmöglichkeiten, etwa durch zentrale Algorithmen und monopolistische Konzerne. Schlussendlich ist die Zukunft der Demokratie nach Streeck nicht durch technokratische Megastrukturen oder durch Privatisierung der politischen Macht bestimmt, sondern durch die Rückbesinnung auf politische Gemeinschaften innerhalb souveräner Nationalstaaten und durch die Stärkung von Dezentralisierung sowie internationalem Frieden. Die globale Politik muss ein Gleichgewicht zwischen der Anerkennung notwendiger internationaler Kooperation und der Achtung demokratischer Selbstbestimmung finden.
Nur so kann die Demokratie den wachsenden Herausforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft wirksam begegnen und die Gefahr autoritärer Rückschläge abwenden. In einer Zeit, in der viele politische Akteure nach schnellen Lösungen und neuen Organisationsformen suchen, bietet die Kritik Streecks eine nüchterne und gut fundierte Perspektive, die den Wert souveräner Staaten und demokratischer Kontrolle hervorhebt. Die Zukunft der Demokratie liegt demnach weder in der Unterwerfung unter eine globale bürokratische Elite, noch in reaktionärer Nationalismusrhetorik, sondern in der Stärkung kleinerer, selbstbestimmter politischer Einheiten, die im Rahmen einer friedlichen internationalen Ordnung kooperieren. Dieses Modell erinnert zugleich an historische Erfahrungen und weist den Weg zu einem nachhaltigen, demokratisch legitimierten Umgang mit den komplexen Herausforderungen der Gegenwart.