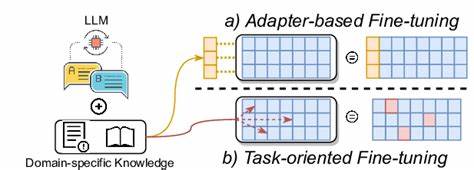In den letzten Jahrzehnten hat das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit enorm an Bedeutung gewonnen. Die Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen und die natürlichen Ressourcen zu schonen, ist unbestritten. Dabei setzen viele Staaten und Unternehmen große Hoffnungen auf die sogenannte grüne Technologie, die erneuerbare Energien, umweltfreundliche Produktionsmethoden und nachhaltige Innovationen umfasst. Ein globaler Wettstreit um die Vorherrschaft in diesem Bereich ist längst entbrannt. Länder investieren Milliarden in Forschung, Entwicklung und den Ausbau grüner Industriezweige.
Doch trotz dieser positiven Entwicklung mehren sich die Stimmen, die vor den Grenzen und Risiken eines solchen Wettbewerbs warnen. Denn die grüne Technologie allein könnte das grundlegende Problem nicht lösen – die Übernutzung und Vernachlässigung der Natur als lebenswichtige Ressource. Der Zustand der natürlichen Umwelt verschlechtert sich weltweit trotz großer technologischer Fortschritte. Studien zeigen, dass seit 1970 ein Großteil der Land- und Meeresflächen durch menschlichen Einfluss grundlegend verändert wurde. Der Verlust von Artenvielfalt, die Verschmutzung von Gewässern, die Ausbeutung der Wälder und die zunehmende Belastung des Klimas sind deutliche Indikatoren dafür, dass ökologische Systeme in einer Krise stecken.
Ein stabiler Klimahaushalt sowie intakte Ökosysteme sind essenziell für die Ernährungssicherheit, Wasserqualität und Gesundheit der Menschen. Diese sogenannten Ökosystemdienstleistungen werden bisher überwiegend gratis zur Verfügung gestellt, finden aber in wirtschaftlichen Betrachtungen selten angemessene Berücksichtigung. Natur wird zu einem billig verfügbaren Rohstoff degradiert, was falsche Anreize schafft. Ein zentrales Problem ist, dass nationale Politiken und ökonomische Systeme natürliche Ressourcen oft nicht als limitierte Vermögenswerte behandeln. Subventionen für fossile Brennstoffe, Landwirtschaft sowie Wasser- und Holznutzung halten die Preise künstlich niedrig und fördern damit eine weiterhin schädliche Nutzung der Umwelt.
Weltweit sind jährlich Subventionen in Höhe von rund 1,8 Billionen US-Dollar auf diese Bereiche gerichtet – etwa zwei Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Dies verzerrt den marktüblichen Wettbewerb zugunsten umweltschädlicher Praktiken und verlangsamt den Übergang zu nachhaltigen Alternativen. Zudem bestehen gewaltige Finanzierungslücken im Naturschutz. Der Schutz und die Wiederherstellung von Biodiversität benötigen jährlich Hunderte Milliarden US-Dollar mehr, als aktuell investiert werden. Unternehmen tun sich ebenfalls schwer, den notwendigen Beitrag zu leisten, obwohl bedeutende Teile der Wirtschaft vom Zustand natürlicher Ressourcen abhängig sind.
Mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung hängt von funktionierenden Ökosystemen ab – dennoch fließen jährlich nur sieben bis acht Milliarden Dollar in nachhaltige Lieferketten, ein Bruchteil des notwendigen Betrags. Trotz dieser Hürden ist im Bereich grüner Technologien ein dynamischer Wettstreit entstanden. Länder wie China, Deutschland, die USA, Japan und Südkorea ringen um Marktanteile bei innovativen Produkten und Prozessen in der regenerativen Energieerzeugung, emissionsarmen Verkehrsmitteln und nachhaltigen Industriewaren. Patentanmeldungen für grüne Technologien und die Einführung strengerer Umweltpolitik sind dabei wichtige Indikatoren für die Wettbewerbsfähigkeit in diesem neuen Wirtschaftssektor. Der Ausbau grüner Industriezweige verspricht nicht nur ökologische Entlastungen, sondern auch ökonomische Chancen, insbesondere vor dem Hintergrund rückläufiger Produktivitätszuwächse in traditionellen Bereichen.
Jedoch bergen solche internationalen Konkurrenzkämpfe auch Risiken. Die Gefahr besteht darin, dass Länder aus Furcht vor dem Verlust wirtschaftlicher Vorteile protektionistische Maßnahmen ergreifen. Der Begriff „grüner Merkantilismus“ beschreibt eine Politik, bei der Steuererleichterungen, Subventionen, Zölle und Vergabebestimmungen dazu genutzt werden, heimische Unternehmen zu bevorzugen und ausländische Wettbewerber auszuschließen. Beispiele hierfür zeigen sich in den Reaktionen auf das US-amerikanische Inflationsbekämpfungsgesetz von 2022, das zahlreiche Regierungen veranlasste, eigene grüne Industriepolitiken mit ähnlichen Protektionselementen zu gestalten. Diese Entwicklung kann Handelsspannungen verschärfen und die internationale Zusammenarbeit behindern.
Die reine Fokussierung auf technologische Innovationen und Konkurrenz vernachlässigt zudem oft die notwendige Sichtweise von Naturschutz und ökologischer Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil von Wirtschaftspolitik. Grüne Technologien alleine werden die bestehenden Probleme nicht lösen, wenn zugleich Umweltzerstörung in anderen Bereichen unbeachtet bleibt. Ohne eine wirksame Preisgestaltung für ökologische Leistungen und eine grundlegende Reform von Anreizsystemen besteht das Risiko, dass Innovationen zum Mittel verbrauchsintensiveren Wachstums und zur Ausweitung des Ressourcenverbrauchs genutzt werden. Dies kann paradoxerweise zu mehr Umweltbelastung führen, statt diese zu reduzieren. Ein entscheidender Schritt für eine erfolgreiche grüne Transformation besteht darin, die Natur als wertvolles Kapital zu behandeln.
Ökosysteme sollten in wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen angemessen bewertet, geschützt und wenn nötig wiederhergestellt werden. Dies erfordert eine Reform der Förderungssysteme, die schädliche Subventionen überflüssig macht und zugleich Investitionen in Biodiversität und nachhaltige Nutzung massiv ausbaut. Nur so lässt sich eine nachhaltige Wirtschaftsweise etablieren, die langfristig ökonomischen Wohlstand mit dem Schutz der Umwelt vereint. Darüber hinaus ist eine verstärkte internationale Zusammenarbeit unverzichtbar. Der Umweltschutz kennt keine nationalen Grenzen.
Klima- und Biodiversitätskrisen können nur durch koordinierte Maßnahmen überwunden werden. Politische Wettbewerbe um grüne Technologien sollten daher nicht in Konflikten und Protektionismus enden, sondern zu einem gemeinsamen Fortschritt führen, der ökologische Ziele und ökonomische Interessen in Einklang bringt. Globale Vereinbarungen, einheitliche Standards und der Austausch von Wissen sind wichtige Bausteine, um die gemeinsamen Herausforderungen anzugehen. Letztlich zeigt die Analyse der aktuellen Entwicklungen, dass der Wettlauf um grüne Technologien eine wichtige, aber nicht ausreichende Antwort auf die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Mehr Prosperität durch grüne Innovationen ist zwar wünschenswert, doch ohne umfassende strukturelle Veränderungen in Wirtschaft und Politik hilft der Wettbewerb allein kaum, den Planeten zu retten.
Nachhaltigkeit erfordert ein Umdenken bezüglich des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur, das jenseits von kurzfristigem ökonomischem Gewinn liegt und auf langfristigen Schutz und nachhaltige Nutzung setzt. Nur durch den Zusammenschluss von Innovation, Regulierung und internationaler Kooperation kann eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen sichergestellt werden.