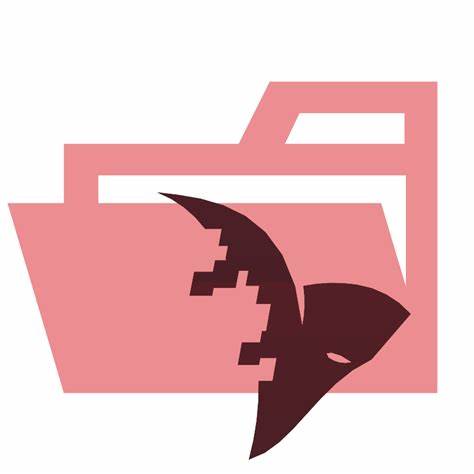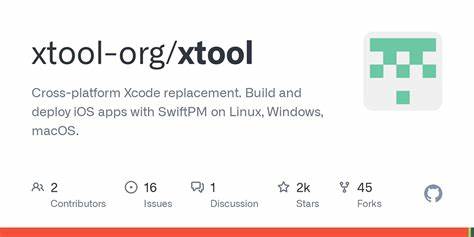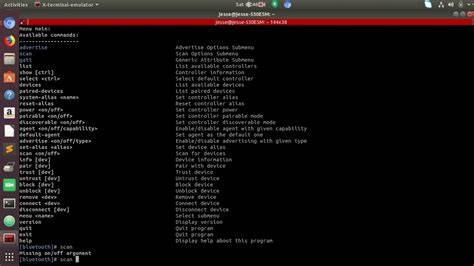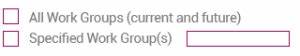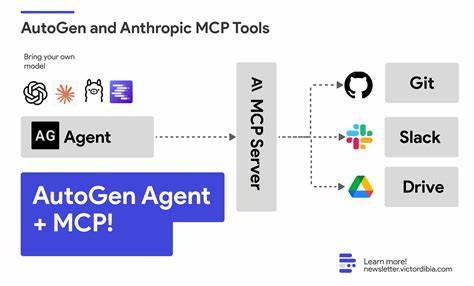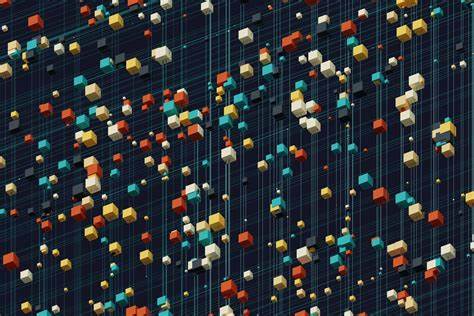Die Handhabung großer Vektordatenbestände gewinnt in Zeiten von KI, maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung zunehmend an Bedeutung. Vektorbasierte Suchindizes ermöglichen es, große Mengen an Embeddings effizient zu durchsuchen, um ähnliche Inhalte, Bilder oder Dokumente schnell und zuverlässig zu finden. Eine verbreitete Annahme ist, dass solche großen Datenmengen zwingend geclustert oder gesharded werden müssen, um Speicher- und Performanceprobleme zu vermeiden. Doch wie sieht es in der Praxis wirklich aus? Ein aktueller Erfahrungsbericht zur Vector Search mit RavenDB verdeutlicht, dass bei moderaten Datengrößen auf das komplexe Sharding verzichtet werden kann – ohne dabei an Geschwindigkeit oder Qualität einzubüßen.RavenDB, eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank, hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Tool für Entwickler im Bereich der Vector Search entwickelt.
Ein zentraler Punkt dabei ist die Unterstützung des HNSW-Algorithmus (Hierarchical Navigable Small World), der als State-of-the-Art-Methode für fast-nearest neighbor Suche gilt. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen wie IVFFlat, bei dem K-Means-Clustering zur Vorpartitionierung verwendet wird, bietet HNSW die Möglichkeit, Indizes inkrementell zu bauen und dauerhaft stabil zu bleiben, selbst bei dynamischen Updates durch Einfügen oder Löschen von Daten.Im Fall eines Beispiel-Datensatzes, der Wikipedia-Embeddings mit etwa 35,1 Millionen Vektoren repräsentiert, wird oft vermutet, dass Sharding unumgänglich ist. Die Datenmenge entspricht grob 120 Gigabyte in Parquet-Dateiformat, während sie in RavenDB als Rohdaten etwa 163 Gigabyte und der HNSW-basierte Index selbst knapp 119 Gigabyte Speicherplatz beansprucht. Das liegt auch daran, dass sowohl die Daten als auch die Vektoren innerhalb des Indexes doppelt gespeichert werden.
Trotz eines Gesamtvolumens von rund 300 Gigabyte konnte der gesamte Index auf einer einzigen Maschine mit 192 Gigabyte RAM aufgebaut werden. Die Indexierung dauerte dabei nur rund zweieinhalb Stunden. Diese Zahl verdeutlicht, dass nicht zwingend eine Verteilung auf mehrere Server notwendig ist, um die Aufgabe effizient zu bewältigen.Interessanterweise konnten auch Maschinen mit deutlich geringeren Speicherkapazitäten für die Indexerstellung genutzt werden, wobei die Dauer mit sinkendem Arbeitsspeicher exponentiell anstieg. Ein System mit 64 Gigabyte RAM benötigte über 14 Stunden, während ein Gerät mit nur 32 Gigabyte RAM sogar knapp 38 Stunden zur Indexierung benötigte.
Diese Ergebnisse zeigen, dass RavenDB auch ohne massig Hardware-Ressourcen arbeiten kann. Trotz der längeren Indexierungszeiten blieben die Abfragezeiten für Vektorsuchen dabei stets schnell und lagen im Bereich von etwa fünf Millisekunden. Somit sind auch weniger potente Systeme zum produktiven Einsatz geeignet, vorausgesetzt die Anforderungen an die Indexierungsfrequenz sind moderat.Der Vergleich mit pgvector, einer populären Postgres-Erweiterung für Vektorindizes, liefert weitere aufschlussreiche Erkenntnisse. Während pgvector für die gleiche kleinere Teilmenge des Datensatzes mit knapp einer halben Million Vektoren und circa 1,6 Gigabyte an Daten gut eine Minute für die Indexierung benötigte, war RavenDB mit rund 77 Sekunden schneller.
Wird bei pgvector der verfügbare Arbeitsspeicher begrenzt und das Parameter maintenance_work_mem auf moderate Werte gesetzt, steigt die Indexierungszeit deutlich an. Erst mit einer Erhöhung des Speichers auf 2 Gigabyte verkürzte sich diese erheblich. Dies legt nahe, dass pgvector bei geringen RAM-Ressourcen stärker in seiner Performance leidet, während RavenDB hier robuster agiert und auch unter limitierten Bedingungen gute Resultate liefert.Neben diesen Performanceaspekten ist auch die Komplexität der Systeme zu berücksichtigen. Sharding ist zwar ein mächtiges Mittel zur horizontalen Skalierung, bringt aber deutlich mehr Verwaltungsaufwand und technische Komplexität mit sich.
Versionierung, Datenkonsistenz, Query-Routing und Lastverteilung sind nur einige der Herausforderungen, die mit einer verteilten Architektur einhergehen. RavenDB besticht hier durch native Unterstützung von Sharding, sodass es grundsätzlich skalierbar ist. Trotzdem zeigt das Praxisbeispiel, dass für Vektorindizes mit einer Größenordnung von bis zu mehreren hundert Gigabyte dies oft nicht erforderlich ist. Die Vorteile einer einfacheren Infrastruktur, geringeren Betriebskosten und leichterer Wartbarkeit sind dabei nicht zu unterschätzen.Hinsichtlich der algorithmischen Umsetzung setzt RavenDB vollständig auf HNSW.
Dieser basiert auf einem Graphenmodell, das schnelles und effizientes Navigieren ermöglicht. Der hohe Grad an Zufallszugriffen, der während der Indexierung entsteht, erfordert ausreichend RAM, um akzeptable Geschwindigkeiten zu gewährleisten. Pgvector bietet hingegen mit IVFFlat noch eine weitere Alternative. Dabei wird die Datenmenge mit K-Means in Cluster eingeteilt, um den Suchbereich deutlich zu verkleinern. Allerdings birgt dieses Verfahren Nachteile wie den Bedarf an kompletter Vorberechnung der Daten und die allmähliche Verschlechterung der Suchqualität nach häufigen Inserts und Deletes.
RavenDB verzichtet daher bewusst auf IVFFlat zugunsten eines stabileren und inkrementell pflegbaren HNSW-Ansatzes.Für Entwickler und Unternehmen bedeutet dies letztlich eine entspanntere Haltung gegenüber der Notwendigkeit von Sharding. Solange die Hardware entsprechend dimensioniert ist, kann man auf „Not Sharding“ setzen und somit Komplexität und Kosten sparen. Die schnelle Vektorindexierung kombiniert mit niedrigen Abfragezeiten erlaubt den effizienten Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsfällen von Suchmaschinen über Empfehlungssysteme bis hin zu KI-gesteuerten Assistenzfunktionen im Unternehmen. Darüber hinaus erleichtert RavenDB die Integration durch einfache Schnittstellen und flexible Datenmodelle.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass RavenDB eine sehr attraktive Lösung für die Handhabung großer Vektorindizes bietet, die ohne Sharding auskommt. Ein sinnvoll dimensionierter Server mit ausreichend RAM reicht aus, um auch 30 Millionen Vektoren auf einer einzigen Maschine performant zu indexieren und abzufragen. Dadurch entfallen viele typische Herausforderungen verteilter Systeme, während gleichzeitig leistungsfähige, skalierbare Suchfunktionalitäten zur Verfügung stehen. Der Vergleich mit anderen Technologien bestätigt die Robustheit und Effizienz von RavenDB unter realen Bedingungen.Der Trend geht in der Vector Search immer stärker zu flexiblen, einfach zu bedienenden Datenbanken, die komplexe Algorithmen im Hintergrund handhaben, ohne den Nutzer mit den Details der Infrastruktur zu belasten.
RavenDB zeigt eindrucksvoll, wie moderne Indexierungsalgorithmen wie HNSW in Kombination mit ausgewogener Hardwareausstattung eine leistungsstarke Basis für KI-getriebene Applikationen schaffen können. Wer also vor der Frage steht, ob Sharding bei der Vector Search unverzichtbar ist, dem kann hier eine klare Antwort gegeben werden: Nicht zwingend. Effizienz, Einfachheit und Zukunftssicherheit sind bei vernünftiger Hardware dank RavenDB durchaus realisierbar – ganz ohne Sharding. Damit belegt RavenDB seinen Status als führende Datenbanklösung im Bereich der semantischen Suche und Vektorverarbeitung.