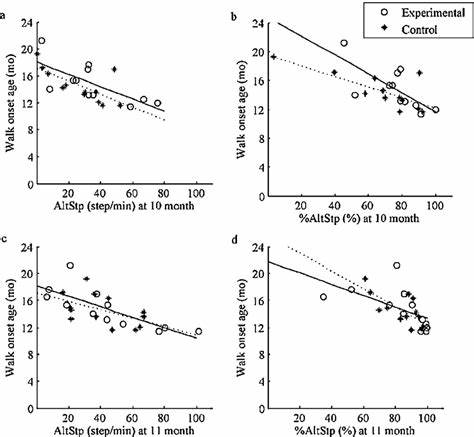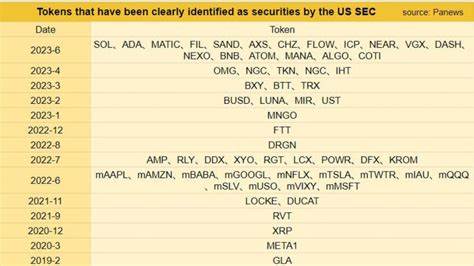Der Zeitpunkt, zu dem ein Kind erstmals eigenständig zu laufen beginnt, gilt als ein bedeutender Meilenstein der frühkindlichen Entwicklung. Diese Verhaltensmarkierung wird nicht nur von Eltern mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, sondern spielt auch in der klinischen Praxis und der öffentlichen Gesundheit eine wichtige Rolle als Indikator für das neuro-motorische Wachstum. Die Variabilität des sogenannten „Age at Onset of Walking“ (AOW), also des Alters beim Beginn des selbstständigen Gehens, ist überraschend groß und reicht bei Kindern europäischer Abstammung typischerweise von acht bis 18 Monaten. Trotz dieser breiten Spanne wissen Wissenschaftler bereits länger um den Einfluss sowohl umweltbedingter als auch genetischer Faktoren auf diesen Prozess. Eine aktuelle umfangreiche Meta-Analyse, die über 70.
000 Säuglinge europäischer Herkunft einbezog, bringt nun mit der Identifikation von über zehn genetischen Signifikanten Loci frischen Wind in das Forschungsfeld und liefert wertvolle Erkenntnisse über die genetische Architektur und biologische Grundlagen dieses wichtigen Entwicklungszeitpunkts. Das selbstständige Gehen stellt nicht nur eine motorische Fähigkeit dar, sondern beeinflusst weitere Entwicklungsbereiche wie die Wahrnehmung und soziale Interaktion. Durch das Aufrichten auf zwei Beine ändert sich die Perspektive der Umweltwahrnehmung fundamental, wodurch Säuglinge andere Möglichkeiten zur Exploration und zum Lernen gewinnen. Die etablierte Leitlinie für Kindesentwicklung, etwa jene von der UK National Institute of Health and Care Excellence (NICE) oder den US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), verwendet das Erreichen des selbstständigen Gehens bis zum 18. Lebensmonat als wichtige Messlatte.
Ein Verzug, der über diesen Zeitrahmen hinausgeht, gilt häufig als Frühwarnzeichen, das eine tiefergehende ärztliche Untersuchung zur Abklärung möglicher Entwicklungsstörungen oder motorischer Einschränkungen einleitet. Trotz der klinischen Relevanz zeigt die Forschung, dass Ursachen für verzögertes Gehen äußerst vielfältig sind. Hierzu zählen genetische Syndrome, Umwelteinflüsse wie schwere Frühgeburtlichkeit, Ernährungszustand, kulturelle Praktiken und variierende Übungsmöglichkeiten. Frühere Zwillingsstudien deuteten darauf hin, dass die Konstitution eines Kindes einen hohen genetischen Anteil an der Entwicklung motorischer Fähigkeiten aufweist, wobei Schätzungen der Heritabilität für das Gehalter Werte von bis zu 80 Prozent erreichten. Diese neue Meta-Analyse untermauert diese Annahmen durch eine SNP-basierte Heritabilität von rund 24 Prozent, was auf eine polygenetische Veranlagung mit einer Vielzahl kleiner Wirkungsgene hinweist.
Die Untersuchung umfasste Daten aus vier großen Kohorten: dem norwegischen Mutter-, Vater- und Kindes-Kohortenstudie (MoBa), dem Niederländischen Zwillingsregister (NTR), der Lifelines-Studie in den Niederlanden sowie der britischen Nationalen Längsschnittstudie für Gesundheit und Entwicklung (NSHD). Die statistische Auswertung mittels Genome-Wide Association Study (GWAS) Meta-Analyse identifizierte elf unabhängige genetische Loci, die den Beginn des selbstständigen Gehens beeinflussen. Eines der interessantesten Gene ist RBL2, das mit einer neuroentwicklungsbezogenen Erkrankung verbunden ist, bei der motorische Verzögerungen und hypotone Muskulatur bekannt sind. Weitere Analysen belegten, dass diese genetisch assoziierten Gene überwiegend im Gehirn exprimiert werden, insbesondere in Regionen mit zentraler Bedeutung für Motorik: Basalganglien, Kortex und Kleinhirn zeigten erhöhte Aktivitätsmuster. Diese sind bekannte Zentren für die Koordination von Bewegungsabläufen.
Interessanterweise korreliert das genetisch determinierte Alter beim ersten Gehen nicht nur mit motorischen Fähigkeiten, sondern steht auch in Beziehung zu kognitiven Funktionen wie Intelligenz und Bildungserfolg. So zeigte sich eine positive genetische Korrelation zwischen späterem Gehen und höherer kognitiver Leistung sowie besserem schulischen Abschluss. Demgegenüber steht eine negative genetische Korrelation mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Körpergewicht – Kinder mit einer genetischen Veranlagung zu einem früheren Gehbeginn zeigen teilweise eine erhöhte Veranlagung für ADHS sowie einen höheren Body-Mass-Index. Diese Befunde liefern wichtige Impulse zur Frage, wie motorische Entwicklung mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen verknüpft ist. Insbesondere der Zusammenhang zwischen Gehbeginn und ADHS mag zunächst kontraintuitiv sein, da eine motorische Verzögerung klinisch oft bei neurologischen Auffälligkeiten beobachtet wird.
Gleichzeitig spricht die genetische Datenlage dafür, dass erhöhte Aktivitätsniveaus oder verminderte Aufmerksamkeitssteuerung zu verstärkter Bewegung und somit unter Umständen zu einem früheren Gehen führen können. Dies verdeutlicht, wie komplex die Wechselwirkungen zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung sind. Auf struktureller Ebene spiegeln sich diese genetischen Einflüsse im Hirnvolumen und in der Faltungskonfiguration der Großhirnrinde wider. Studien an Neugeborenen zeigten, dass ein höherer Polygenetik-Wert für einen späteren Gehbeginn mit vergrößerten Volumen in Hirnregionen assoziiert ist, die für Bewegungskontrolle verantwortlich sind, darunter Basalganglien, das Kleinhirn und Hirnstammareale. Hinzu kommt, dass die Gyrifikation, also die Faltung der Großhirnrinde, in motorisch relevanten Bereichen wie dem somatosensorischen und prämotorischen Kortex genetisch positiv mit dem Verlauf des Gehbeginns korreliert.
Diese neuroanatomischen Zusammenhänge unterstreichen, dass die genetisch veranlagten Unterschiede sich schon vor der Geburt im Gehirn manifestieren und sich auf wichtige motorische Prozesse auswirken. Der Einsatz von Polygenetik-Scoring (PGS) macht es möglich, individuelle genetische Profile zu bestimmen, die eine Vorhersage des Geh-Alters in unterschiedlichen Datensätzen mit einer erklärten Varianz von bis zu 5,6 Prozent erlauben. Besonders bemerkenswert ist, dass Schätzungen aus Zwillingsanalysen zeigten, dass diese associierten genetischen Effekte vor allem direkte Einflüsse darstellen und nicht durch indirekte Effekte wie etwa der Erziehung oder soziales Umfeld verfälscht werden. Dies weist darauf hin, dass genetische Varianten einen unmittelbaren Beitrag zur motorischen Entwicklung leisten. Die Ergebnisse dieser Studie besitzen weitreichende praktische und wissenschaftliche Bedeutung.
Klinisch gesehen könnte die Integration genetischer Risikoprofile künftig die Einschätzung von Entwicklungsverzögerungen verbessern, insbesondere durch genauere Differenzierung zwischen variabler normaler Entwicklung und pathologischen Mustern. Zudem erweitern die Erkenntnisse das Verständnis der genetischen Überschneidungen zwischen Motorik, kognitiver Entwicklung und neuropsychiatrischen Erkrankungen und bieten Ansatzpunkte für weitere Forschung an den biologischen Mechanismen der kindlichen Entwicklung. Die Untersuchung zeigt jedoch auch Limitationen auf. So konzentrierte sich die Studie ausschließlich auf Kinder europäischer Abstammung, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Zudem beruht das Alter beim ersten Gehen in den Kohorten zum Teil auf elterlicher Erinnerung, was eine Fehlerquelle darstellt.
Künftige Arbeiten sollten multikulturelle und transethnische Populationen evaluieren, um umfassendere Erkenntnisse zu erlangen. Darüber hinaus könnten weitere Untersuchungen lokale genetische Korrelationen entlang des Genoms und Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren einbeziehen, um differenziertere Modelle motorischer Entwicklung zu entwickeln. Zusammenfassend offenbart die Meta-Analyse der genetischen Assoziationen des Geh-Anfangsalters bei über 70.000 europäischen Säuglingen, dass es sich beim Gehbeginnen um ein hochpolygenes, erbliches Merkmal handelt, das biologisch tief mit der Entwicklung des Gehirns sowie kognitiven und neuropsychiatrischen Merkmalen verknüpft ist. Die identifizierten genetischen Regionen und Gene, speziell das RBL2-Gen, liefern Anhaltspunkte für Schlüsselprozesse in der Motorikentwicklung.
Diese Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten für die Früherkennung, Intervention und das Verständnis der Entwicklung motorischer Fähigkeiten bei Kindern – ein Kernbereich der Neurowissenschaften und Pädiatrie, der für Familien und Gesellschaft große Relevanz besitzt.