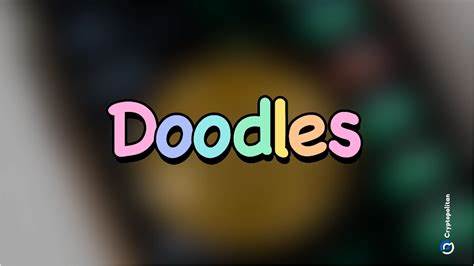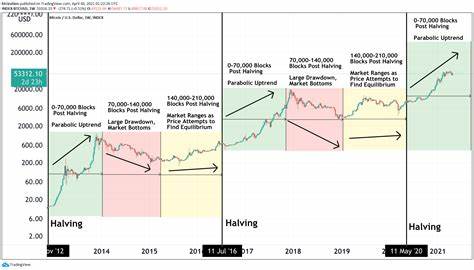In einer Welt, in der das Thema Vermögensungleichheit immer mehr an Bedeutung gewinnt, stellt die Handlung von Marlene Engelhorn ein bemerkenswertes Beispiel für gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein dar. Die 33-jährige Erbin des deutschen Chemie- und Pharmariesen BASF stand im Jahr 2022 plötzlich vor der Herausforderung, ein Erbe von nahezu 27 Millionen Euro anzutreten. Doch anstatt diesen erheblichen Reichtum für sich zu behalten, traf sie eine ungewöhnliche Entscheidung: Sie spendete etwa 92 Prozent ihrer Erbschaft an gemeinnützige Organisationen und setzt sich selbst dafür ein, große Vermögen stärker zu besteuern. Engelhorns Ansatz wirft grundsätzliche Fragen über das Erbrecht und die Rolle des Erbes in modernen Gesellschaften auf und fordert das Konzept der Erbschaft als gerechtfertigte Form der Vermögensweitergabe heraus. Marlene Engelhorn ist keine gewöhnliche Erbin.
Als Nachfahrin von Friedrich Engelhorn, dem Gründer eines der größten Chemieunternehmen der Welt, wuchs sie in einem Umfeld auf, das von großem materiellen Wohlstand geprägt war. Doch zugleich bot ihr das Studium der Literatur einen anderen Blickwinkel auf die Welt und ihre soziale Dynamik. Sie beschreibt ihr Aufwachsen im Wohlstand als „goldenen Käfig“, der ihr sowohl Privilegien als auch eine Form von Begrenzung auferlegte. Dies führte zu einem kritischen Bewusstsein und der Erkenntnis, dass Reichtum nicht zwangsläufig mit mehr Freiheit oder Kompetenz gleichzusetzen ist. Engelhorn betont, dass die ultrareichen Familien ihre eigene Welt bilden – mit privaten Schulen, exklusiver medizinischer Versorgung und abgeschirmten Wohnvierteln.
Diese Distanz zur allgemeinen Gesellschaft fördert ihrer Ansicht nach ein Gefühl von Überlegenheit und Trennung. „Die ultrareichen glauben, im Zentrum der Gesellschaft zu stehen, während sie eigentlich eher am Rand agieren“, so Engelhorn. Diese soziale Sonderstellung wird durch den Erbmechanismus zementiert, der Wohlstand innerhalb weniger Familiengenerationen konserviert und Ungleichheiten verstärkt. Die Entscheidung, einen Großteil ihres Erbes weiterzugeben, ist für Marlene Engelhorn ein praktischer Ausdruck ihrer Überzeugung, dass Erbschaften eine Form der Ungerechtigkeit darstellen. Sie betrachtet das traditionelle Erbrecht als ein System, das systematisch Ungleichheit fördert, da es Menschen privilegiert, die ohne eigene Leistung zu großem Reichtum gelangen.
Ihre Haltung ist geprägt von der Überzeugung, dass Vermögen nicht ohne gesellschaftliche Verantwortung vorhanden sein sollte. Die Spenden Märchens wurden an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen übergeben, die sich für soziale Gerechtigkeit, Bildung, Umweltschutz und Gesundheitsfürsorge einsetzen. Damit will sie nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern auch ein Signal setzen für einen bewussteren Umgang mit Vermögen. Engelhorn selbst engagiert sich öffentlich für höhere Steuern auf Reichtum, insbesondere auch auf große Erbschaften. Ihre Berufung ist klar: Die Reichen müssen ihren Beitrag leisten, um gesellschaftliche Ungleichheiten abzubauen und die Demokratie zu stärken.
Die Debatte um Erbschaften ist in Deutschland und weltweit von großer Brisanz. Einerseits gilt das Erbrecht als fest verankerter Bestandteil der Eigentumsordnung, durch den der familiäre Wohlstand bewahrt werden kann. Andererseits führt diese Praxis zu einer wachsenden Konzentration von Vermögen in den Händen weniger Familien, was soziale Spannungen und wirtschaftliche Ungleichheiten begünstigt. Viele Experten argumentieren, dass Erbschaften meritokratische Prinzipien untergraben, indem sie Reichtum ohne Gegenleistung weitergeben. Marlene Engelhorns Fall veranschaulicht zudem die Auswirkungen des Erbes auf die individuelle Identität und gesellschaftliche Wahrnehmung.
Sie spricht davon, dass ihr umfangreicher Wohlstand keine persönliche Leistung repräsentiert, sondern ein zufälliges Geschenk der Geburt. Dieses Bewusstsein ist selten unter denjenigen, die von großem Erbe profitieren, erklärt aber ihre Haltung, das Geld nicht selbst zu behalten, sondern es zum Gemeinwohl einzusetzen. Diese Geschichte wirft auch ein Licht auf die wachsende Bewegung innerhalb der jüngeren Generationen von Superreichen, die sich kritisch mit dem Erbe und dem Umgang mit Reichtum auseinandersetzen. In Zeiten von Klimakrise, sozialen Ungleichheiten und politischer Instabilität erkennen viele junge Erben zunehmend ihre soziale Verantwortung. Einige entscheiden sich bewusst für Philanthropie oder eine aktive Rolle im gesellschaftlichen Wandel, statt das Vermögen ungebremst anzuhäufen.
Neben den persönlichen Motiven von Marlene Engelhorn stellt sich auch die Frage nach den Rahmenbedingungen, die solche Entscheidungen begünstigen oder behindern. Steuerliche Regelungen, politische Debatten und gesellschaftliche Normen spielen eine entscheidende Rolle darin, ob Vermögen weitergegeben, investiert oder umverteilt wird. In Deutschland beispielsweise sind Erbschaftssteuern vorhanden, doch oft gibt es Ausnahmen, die die Vermögensweitergabe erleichtern. Kritiker fordern daher strengere und gerechtere Steuersysteme, um den Einfluss von Erbschaften auf die Vermögenskonzentration zu reduzieren. Marlene Engelhorns Engagement für die Besteuerung der Superreichen und ihre Ablehnung der Erbschaftspraxis haben auch internationale Bedeutung.
Denn die globale Ungleichheit nimmt weiter zu, und die Diskussion um Reichtumsbesteuerung gewinnt in vielen Ländern an Fahrt. World Economic Forum, OECD und andere Organisationen belegen in ihren Berichten die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und fordern Reformen zur Bekämpfung dieser Entwicklung. Darüber hinaus berührt die Debatte auch fundamentale Fragen der Gerechtigkeit und Solidarität. Kann es gerecht sein, dass einige wenige durch Geburt zu großem Reichtum gelangen, während Millionen Menschen weltweit in Armut leben müssen? Wie kann ein System gestaltet werden, das Chancen für alle eröffnet und zugleich individuelle Anstrengungen anerkennt? Die Haltung von Engelhorn ist eine eindringliche Einladung, diese Fragen neu zu überdenken und gesellschaftliche Veränderungen zu fördern. Die mediale Aufmerksamkeit, die ihr Fall erhält, setzt Impulse für weiterführende Diskussionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Es wird deutlich, dass Erbschaften nicht nur eine private Angelegenheit sind, sondern politisch und ethisch relevante Themenfelder darstellen. Marlene Engelhorns Beispiel macht Mut, die Macht des Geldes kritisch zu hinterfragen und den Fokus auf soziale Verantwortung und nachhaltige Umverteilung zu legen. Mit ihrem mutigen Schritt stellt sie das herkömmliche Verständnis von Reichtum infrage und zeigt, dass auch innerhalb der privilegierten Schichten ein Wandel möglich ist. Ihr Handeln könnte wegweisend sein für mehr soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeitsdenken, das nicht nur auf individuellen Vorteil, sondern auf gemeinschaftliches Wohl ausgerichtet ist. Zusammenfassend zeigt die Geschichte von Marlene Engelhorn eindrucksvoll, dass Erbschaften eine gesellschaftliche Herausforderung darstellen, die weit über familiäre Interessen hinausgeht.
Ihre Entscheidung, einen Großteil ihres Vermögens zu spenden und sich für die Besteuerung von Reichtum einzusetzen, demonstriert ein tiefes Verständnis von sozialer Verantwortung. Gleichzeitig bringt sie wichtige gesellschaftliche Diskussionen voran, die für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft essenziell sind. Ihr Engagement ist ein Aufruf an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Erbschaften kritisch zu hinterfragen und den Weg für eine gerechtere Verteilung von Wohlstand zu ebnen.