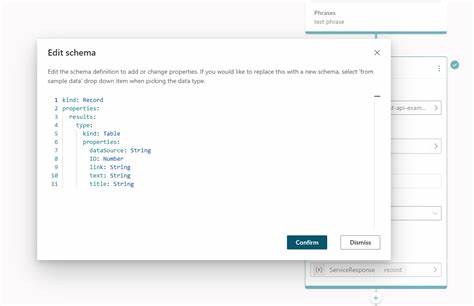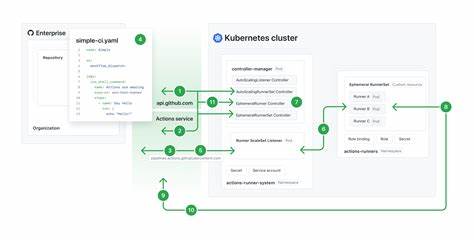Seit Jahrzehnten haben arabische Militärkräfte auf dem Schlachtfeld oftmals enttäuschende Leistungen gezeigt. Trotz enormer personeller Ressourcen und oft hoher Rüstungsausgaben sind arabische Armeen in diversen bewaffneten Konflikten weltweit selten siegreich hervorgegangen. Historische Beispiele reichen von militärischen Niederlagen gegen Israel bis hin zu durchschnittlichen bis schlechten Leistungen in konfliktreichen Situationen wie dem Jom-Kippur-Krieg 1973, dem Golfkrieg 1990/91 oder regionalen Konflikten im Nahen Osten. Welche Gründe verbergen sich hinter dieser wiederkehrenden militärischen Schwäche? Die Ursachen liegen weit über die reine Technologie oder finanzielle Ausstattung hinaus und setzen tief an in kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Strukturen der arabischen Welt. Nur ein holistischer Blick auf all diese Faktoren kann ein klareres Verständnis ermöglichen.
Die Bedeutung der Kultur im Militärwesen arabischer Staaten kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Anders als in westlichen Streitkräften, die üblicherweise auf Dezentralisierung, Eigeninitiative und flexible Entscheidungsfindung setzen, zeichnen sich arabische Armeen häufig durch eine starke Hierarchisierung und Zentralisierung aus. Entscheidungen werden von oben herab diktiert, während untere Offiziere und insbesondere Mannschaften wenig Entscheidungsfreiheit haben. Ein solcher Führungsstil unterdrückt Kreativität und Initiative – Tugenden, die im modernen Gefecht essenziell sind, um schnell auf unerwartete Situationen reagieren zu können. Viele arabische Offiziere vermeiden es, eigenständig Entscheidungen zu treffen, aus Angst vor negativen Konsequenzen bei Fehlern.
Innovation und eigenständiges Handeln werden so systematisch entmutigt. Diese dominante Kontrollstruktur ist eng verbunden mit der politischen Kultur der Region, geprägt von Misstrauen, Paranoia und einem tiefen Bedürfnis nach Machtkonsolidierung der herrschenden Eliten. Militärische Institutionen dienen häufig primär zur Sicherung der Herrschaftsposition der politischen Führung und weniger wirklich der Landesverteidigung. Aus Furcht vor Putschversuchen oder inneren Machtkämpfen werden Strukturprozesse künstlich kompliziert und durch vielfache Kontrollinstanzen verlangsamt – dadurch leidet auch die operative Handlungsfähigkeit enorm. Selbst bei größeren Übungen oder Koordinationsmaßnahmen vermeiden arabische Regierungen bewusst echte Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Waffengattungen oder Militärzweigen, weil diese Kooperation den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen und informellen Netzwerken fördern könnte, die eine Gefährdung der bestehenden Machtbalance darstellen.
Ein weiteres gravierendes Problem liegt in der Ausbildung und dem Verhältnis zwischen Offizieren und einfachen Soldaten. Klassengegensätze sind in arabischen Streitkräften besonders stark ausgeprägt, oft vergleichbar mit gesellschaftlichen Kastensystemen. Offiziere betrachten Mannschaftsdienstgrade häufig nicht als gleichwertige Kameraden, sondern vielmehr als untergeordnete Hilfskräfte. Dies führt zu geringer Loyalität und fehlendem Zusammenhalt auf der unteren Ebene, was im Gefecht schnell zum Zusammenbruch von Einheiten führen kann. Anders als in westlichen Armeen, wo die Entwicklung einer professionellen Unteroffizierskaste (NCOs) als entscheidender Brückenschlag zwischen Führung und Soldaten gilt, sind funktionierende NCO-Strukturen in arabischen Streitkräften oft nicht existent oder wenig anerkannt.
Die Konsequenz ist mangelnde Disziplin und fehlende Kompetenz in der Praxis, die sich negativ auf Kampfeffektivität und Durchhaltewillen auswirken. Die Ausbildung selbst leidet erheblich unter dem arabischen Bildungssystem, das stark auf Auswendiglernen und passive Aufnahme statt auf kritisches Denken, Analyse oder kreative Problemlösung setzt. Offiziere werden zwar gut in technischen Details geschult, jedoch bleiben ihnen oft Fähigkeiten zur selbstständigen Führung und Entscheidungsfindung verwehrt. Das verhindert, dass Soldaten unter unerwartetem Druck flexibel reagieren, improvisieren oder Verantwortung übernehmen können. Gleichzeitig existiert eine ausgeprägte Angst davor, in der Öffentlichkeit Fehler zu machen oder zu scheitern, was den Lernprozess zusätzlich lähmt.
Dieses Klima führt dazu, dass sowohl Lehrer als auch Schüler innerhalb der Militärschulen wenig Anreize haben, wirklich über den Tellerrand hinaus zu denken oder Initiative zu entwickeln. Des Weiteren spielt der Umgang mit Informationen eine wichtige Rolle. Arabische Offiziere und Experten neigen dazu, Wissen bewusst zu horten und nicht breit zu teilen, um ihre eigene Bedeutung zu sichern. Dieses Professionsgeheimnis behindert den Aufbau von kollektiver Kompetenz und verhindert, dass auch andere Soldaten technisches Know-how erwerben, das im Gefecht entscheidend sein kann – etwa um bei Ausfall eines Kameraden dessen Funktion vorübergehend zu übernehmen. Gleichzeitig führt diese Informationszurückhaltung zu innerer Fragmentierung der Einheiten und behindert den Wissensaustausch, der für eine moderne, vernetzte Kriegsführung essenziell ist.
Ein Muster, das sich in praktisch allen arabischen Armeen findet, ist die schwache Fähigkeit zu kombinierten Waffenoperationen. Die Integration von Infanterie, Panzertruppen, Artillerie und Luftwaffe gelingt meist nicht, weil Vertrauen unter den einzelnen Truppenteilen fehlt und gemeinsame Übungen rar sind. Dies liegt wiederum an der starken Verspielung politischer Machtinteressen: Unterschiedliche bewaffnete Einheiten werden gegeneinander ausgespielt, um eine zu starke Machtkonzentration an einer Stelle zu verhindern. Paranoide Sicherheitsmaßnahmen und das Bestreben, Machtfragmente auseinanderzuhalten, machen integrierte Einsatzstrukturen praktisch unmöglich. Beispielsweise sind rivalisierende Garde- oder Sicherheitsverbände eine verbreitete Praxis, die zwar die Regimesicherung stärkt, aber gleichzeitig die militärische Effektivität erheblich schwächt.
Auch das große politische und gesellschaftliche Geflecht der Region mit seinen vielfältigen ethnischen, religiösen und sozialen Gruppen spielt eine Rolle. Militärische Karrieren sowie Offiziersbeförderungen werden oft durch konfessionelle oder stammesbezogene Loyalitäten geprägt, statt durch objektive Leistungen oder Verdienste. Das führt zu einer Fehlausrichtung der Personalpolitik und erschwert die Bildung kohärenter, funktionsfähiger Großverbände. Die geringe interne Vertrauensbasis wird zudem durch eine zwischenstaatliche Rivalität zwischen den verschiedenen arabischen Ländern verstärkt. Kooperation im militärischen Bereich findet kaum statt, da Misstrauen und Machtkalküle jeglichen Zusammenschluss verhindern.
Neben den kulturellen und gesellschaftlichen Ursachen beeinträchtigt auch eine weitverbreitete Geringschätzung für den Schutz des eigenen Personals an der Effektivität arabischer Streitkräfte. Die mangelnde Fürsorge für Soldaten, schlechte logistische Versorgung, mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen bei Übungen und das geringe Verantwortungsbewusstsein der Führungsebene gegenüber den Truppen führen zu einer niedrigen Moral. Soldaten empfinden sich oft als Ersatzmaterial und nicht als geschätzte Kameraden, was den Kampffähigkeiten abträglich ist. Auch politisch motivierte Fehlinformationen oder bewusste Täuschungen innerhalb der eigenen Streitkräfte, wie sie in der Vergangenheit vor Kriegen beobachtet wurden, sowiesen auf eine fragile Vertrauensbasis hin. Militärische Technik und moderne Waffensysteme, die arabische Länder in großem Umfang importieren, können ihre Schwächen nicht ausgleichen.
Viele Streitkräfte haben große Probleme, die komplexen westlichen oder sowjetischen Technologien zu warten und effizient einzusetzen. Herausforderungen in der Logistik und Ersatzteilversorgung zusammen mit der fehlenden Bereitschaft, Verantwortung an die unteren Ebenen zu delegieren, führen zu oft unnötig vielen Ausfällen. Die mentalen und organisatorischen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Handling hochmoderner Systeme sind vielfach nicht gegeben. Die Versuche westlicher und ehemaliger sowjetischer Ausbildungsanbieter, die Leistungsfähigkeit arabischer Streitkräfte zu verbessern, stößt oft an kulturellen Barrieren. Lehrmethoden beispielsweise, die Eigeninitiative und kritisches Denken einfordern, finden wenig Resonanz.
Die starre Hierarchie und der autoritäre Führungsstil stehen in Widerspruch zum westlichen ideal der offenen Kommunikation. Gleichzeitig kann die Angst vor Demütigung oder persönlichem Gesichtsverlust verhindern, dass offen Fehlentwicklungen und Schwächen angesprochen werden. Ohne eine tiefergehende Reform sowohl im militärischen Ausbildungswesen als auch im gesellschaftlichen und politischen Umfeld bleiben viele dieser Probleme bestehen. Langfristige Veränderungen sind eng an den politischen Wandel in der arabischen Welt gebunden. Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit setzen Vertrauen, Transparenz und Verantwortungsbewusstsein voraus, die sich direkt auf die militärische Leistungsfähigkeit übertragen können.
Militärische Professionalität entsteht nur in einem Umfeld, das individuelle Leistung anerkennt, Fehler konstruktiv behandelt und eine offene Fehlerkultur etabliert. Der Weg dahin scheint jedoch angesichts der tief verwurzelten Strukturen und der anhaltenden politischen Instabilität noch weit. Abschließend lässt sich festhalten, dass die militärische Erfolglosigkeit arabischer Streitkräfte vor allem auf ein komplexes Zusammenspiel von kulturellen, sozialen und politischen Faktoren zurückzuführen ist. Während technische und materielle Voraussetzungen wichtig bleiben, entscheidet die Haltung der Menschen zueinander, die Qualität der Führung und die Art und Weise, wie Wissen vermittelt und geteilt wird, über Sieg oder Niederlage. Der Aufbau moderner, erfolgreicher militärischer Organisationen erfordert daher nicht nur Investitionen in Hardware, sondern eine grundlegende Neuausrichtung von Ausbildung, Führung und gesellschaftlicher Kultur.
Solange diese Veränderungen ausbleiben, bleiben arabische Armeen trotz allen Bemühungen meist hinter ihren militärischen Potenzialen zurück.



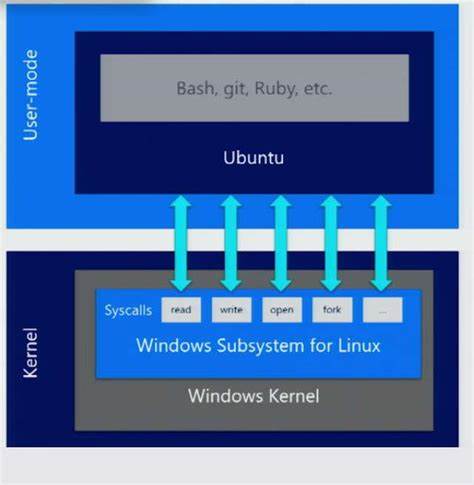

![Computation Isn't Consciousness: The Chinese Room Experiment [video]](/images/280B87E9-9AED-48EC-90F9-FFCFFEE6EABC)