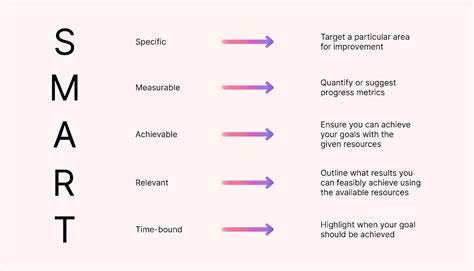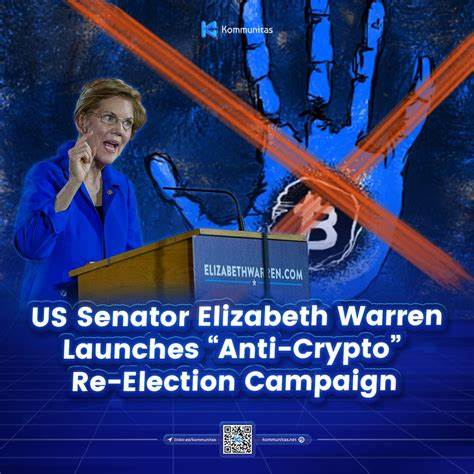Unterseekabel bilden das Rückgrat der globalen digitalen Kommunikation. Sie übertragen rund 99 Prozent des internationalen Datenverkehrs und sind damit von immenser Bedeutung für Wirtschaft, Verteidigung und den Alltag der Bevölkerung. Insbesondere das Vereinigte Königreich, das als wichtiger Hub für Euro-Atlantik-Kabelverbindungen fungiert, steht im Fokus potenzieller Attacken. Eine neue Analyse des China Strategic Risks Institute (CSRI) verdeutlicht jedoch, dass Großbritannien bislang unzureichend darauf vorbereitet ist, einem gezielten Angriff auf diese kritische Infrastruktur entgegenzuwirken. Seit Anfang 2021 ereigneten sich mehrere Zwischenfälle, bei denen unterseeische Kabel sabotiert wurden oder zumindest der Verdacht auf Sabotage bestand.
Die Untersuchungen legen nahe, dass eine Vielzahl der verdächtigen operativen Schiffe entweder chinesischer oder russischer Herkunft zuzuordnen sind. Dabei operieren diese Länder nach einem sogenannten „Grauzonen“-Ansatz, der bewusst unter der Schwelle eines offenen Kriegsaggressionsaktes bleibt, jedoch gezielt kritische Infrastrukturattacken durchführt, um politische und wirtschaftliche Gegner zu schwächen, ohne klare Gegenmaßnahmen zu provozieren. Diese Strategie der „Grauzonen“-Konflikte ist besonders tückisch, da sie es den betroffenen Staaten erschwert, effektiv zu reagieren. Offensive Operationen wie das gezielte Manipulieren oder Zerstören von Unterseekabeln durch kommerziell getarnte „Schattenflotten“-Schiffe erlauben es, Schäden anzurichten, ohne direkt konventionelle militärische Mittel einzusetzen. Dies schafft eine schier endlose Grauzone, in der eine Antwort entweder überzogen oder unzureichend erscheint.
Das Vereinigte Königreich, trotz seiner zentralen Position im weltweiten Kabelnetz, verfügt über begrenzte Ressourcen, um die maritime Überwachung entlang seiner Küsten und in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) zu gewährleisten. Die Küstenradarabdeckung umfasst lediglich knapp über ein Fünftel des Gebiets, was die lückenlose Kontrolle des Schiffsverkehrs erheblich erschwert. Hinzu kommt das hohe Verkehrsaufkommen auf See, das es nahezu unmöglich macht, jeden unregelmäßigen oder potenziell schädlichen Bewegungsablauf rechtzeitig zu identifizieren. Die dadurch entstehenden Sicherheitslücken sind besonders beunruhigend, zumal Unterseekabel nicht nur für zivile Kommunikation wie internationale Banktransaktionen, Cloud-Dienste oder virtuelle Meetings entscheidend sind, sondern auch essentielle militärische Kommunikationswege darstellen. Ein Ausfall könnte dramatische Folgen für die nationale Wirtschaft und die Verteidigungsfähigkeit des Landes haben.
Die politische Dimension dieser Bedrohung zeigt sich in der engen mutmaßlichen Kooperation zwischen Moskau und Peking. In verschiedenen Regionen wurden offenbar koordinierte Angriffe beobachtet, etwa im Ostseeraum mit chinesischen Schiffen und in der Gegend um Taiwan mit russischen Akteuren. Dieses Zusammenwirken erhöht die Komplexität der Gefahr und gibt Anlass, strategische Allianzen und Ermittlungen auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Die bisherigen gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie die seit dem 19. Jahrhundert geltende Kabelkonvention, bieten kaum noch adäquaten Schutz für die hochmoderne und digitalisierte Infrastruktur von heute.
Rechtsdurchsetzung gestaltet sich schwierig, nicht zuletzt, weil der Nachweis der vorsätzlichen Sabotage oft an der Abgrenzung zu fahrlässigem Verhalten scheitert. Ein bekannter Fall aus Taiwan veranschaulicht dies: Hier wurde ein chinesischer Kapitän zu einer Haftstrafe verurteilt, nachdem er absichtlich Unterseekabel beschädigt hatte, doch die Verteidigung argumentierte, es handele sich um einen Unfall. Vor diesem Hintergrund fordern Experten eine verstärkte Überwachung des maritimen Verkehrs durch moderne Sensorik, Drohnen und Satelliten sowie engere Kooperationen mit Ländern, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Grauzonentaktiken gesammelt haben, wie Taiwan. Letzteres hat in der Tat bereits Schritte unternommen, um Angriffen auf seine Kabelinfrastruktur entgegenzuwirken und könnte als Modell für Schutzmechanismen dienen. Die jüngste strategische Verteidigungsüberprüfung des Vereinigten Königreichs weist darauf hin, dass Unterseekabel als zunehmend verletzlicher maritimer Bereich erkannt werden.
Dennoch fehlt bislang ein umfassendes und effektives Konzept, um diese Schwachstelle gezielt zu adressieren. Angesichts der fortschreitenden digitalen Vernetzung und der strategischen Bedeutung dieser Infrastruktur ist ein Umdenken dringend notwendig. Darüber hinaus sollten politische und wirtschaftliche Maßnahmen zur Eindämmung der Bedrohungen geprüft werden. Neben der technischen Sicherung der Kabel wären internationale diplomatische Initiativen gefragt, um mit China und Russland Verhaltensregeln zu etablieren oder zumindest eine Eskalation zu verhindern. Die NATO und andere multilaterale Organisationen könnten dabei eine zentrale Rolle spielen, ebenso wie nationale Sicherheitsbehörden und private Unternehmen, die Betreiber der Kabelnetze sind.
Abschließend lässt sich festhalten, dass das Vereinigte Königreich die Bedrohungslage rund um seine Unterseekabelinfrastruktur nicht unterschätzen darf. Die Kombination aus begrenzter Überwachungskapazität, hochgradig vernetzten digitalen Systemen und aggressiven Sabotageversuchen durch Staatsakteure erhöht das Risiko von schwerwiegenden Ausfällen. Nur durch einen koordinierten Ansatz, der technologische Innovation, internationale Zusammenarbeit und rechtliche Nachbesserungen umfasst, kann die Sicherheit dieser lebenswichtigen Infrastruktur langfristig gewährleistet werden.