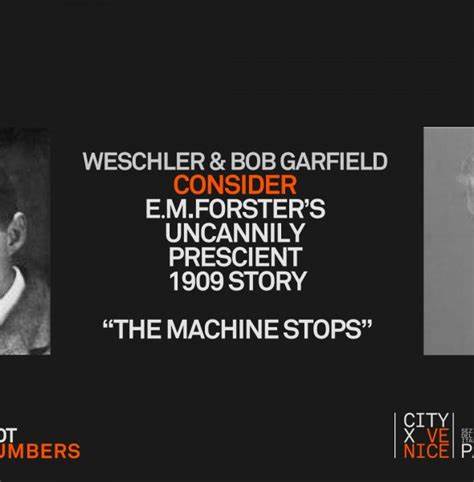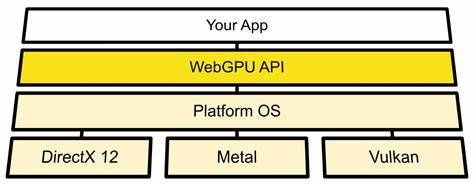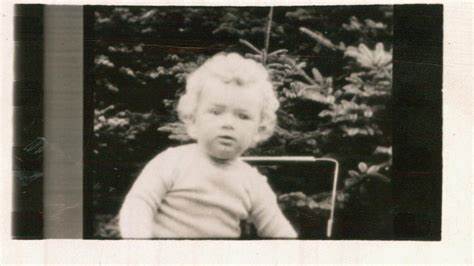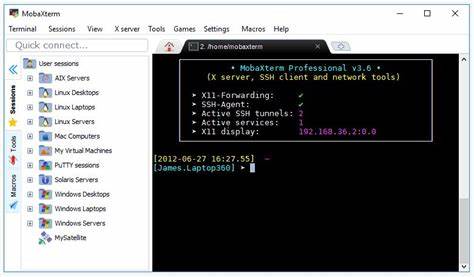Die Welt der nicht-fungiblen Token, besser bekannt als NFTs, hat in den letzten Jahren immens an Aufmerksamkeit gewonnen. Mehr und mehr große Unternehmen setzen auf digitale Assets, um neue Märkte zu erschließen und ihre Marken innovativ zu präsentieren. Doch mit dieser Entwicklung kommen auch neue Risiken und rechtliche Fragestellungen, wie der jüngste Rechtsstreit rund um Nike eindrucksvoll zeigt. Im Jahr 2025 wurde Nike im Bundesgericht von New York mit einer Sammelklage konfrontiert, die den Vorwurf erhebt, dass das Unternehmen zusammen mit seiner Tochtergesellschaft RTFKT Käufer von NFTs getäuscht und betrogen habe. Die Kläger werfen Nike vor, durch übertriebene Werbung und nicht eingehaltene Versprechen Investoren angelockt zu haben, nur um danach durch die Einstellung und den Rückzug von RTFKT die Wertlosigkeit der digitalen Vermögenswerte herbeizuführen.
NFTs repräsentieren digitale Gegenstände oder Rechte, die einzigartig sind und nicht austauschbar. Sie finden Anwendung in Kunst, Musik, Games oder auch im sportlichen Bereich. Nike hatte im frühen Jahr 2022 gemeinsam mit RTFKT die sogenannte Dunk Genesis CryptoKick NFT-Reihe veröffentlicht. Die Innovation dieses Angebots bestand darin, traditionelle Sneaker mit der Blockchain-Technologie zu verbinden und so physische und digitale Produkte miteinander zu verknüpfen. Die NFT-Inhaber hätten dadurch exklusive Rechte, Sammlerwert und potenzielle Nutzung innerhalb virtueller Welten erhalten sollen.
Doch offenbar verlief das Projekt nicht so erfolgreich wie erwartet. Die Kläger argumentieren, dass Nike und RTFKT die Projektchancen bewusst aufgebauscht und potenzielle Risiken verschleiert hätten. Infolgedessen mussten viele Käufer mit enormen Verlusten leben, weil der Wert der CryptoKicks dramatisch eingebrochen ist und die Einnahmequelle durch das Schließen der RTFKT-Division versiegt ist. Ein weiteres Streitfeld in diesem komplexen Fall ist die Frage, ob es sich bei den verkauften NFTs tatsächlich um unregistrierte Wertpapiere handelt. In den vergangenen Jahren hat die US-Börsenaufsicht SEC die Klassifikation digitaler Vermögenswerte als Wertpapier oder nicht immer wieder neu bewertet.
Insbesondere unter der Trump-Administration gab es eine gewisse Lockerung im Umgang mit Kryptowährungen, was es für Kläger schwieriger macht, den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Wertpapiergesetz durchzusetzen. Juristin Nicolle Lafosse vom internationalen Kanzleinetzwerk Diaz Reus weist auf diese Unsicherheit hin und erläutert, dass eine Klage, die noch unter anderem regulatorischen Rahmenbedingungen eingereicht würde, womöglich eine andere rechtliche Wirkung entfalten könnte. Die Nike-Klage ist aber kein Einzelfall. Immer mehr Verbraucher wenden sich mit Vorwürfen des sogenannten „Rug Pulls“ an die Gerichte – einer betrügerischen Praxis, bei der Projektinitiatoren Investitionen einsammeln und dann plötzlich verschwinden, ohne die versprochenen Leistungen zu erbringen. Während diese Taktik bislang vor allem in Krypto-Startups beachtet wurde, zeigt der Fall Nike, dass auch renommierte Konzerne unter Druck geraten, wenn sie ohne ausreichende Transparenz in den digitalen Assets Sektor einsteigen.
Die Kläger in der Nike-Sache stützen sich auch auf Verbraucherschutzgesetze auf Staatsebene, um den komplexen Hindernissen des Bundeswertpapierrechts zu entgehen. Bundesrechtliche Vorgaben sind in der Kryptoregulation oft lückenhaft oder müssen erst noch ausgearbeitet werden. Staatliche Verbraucherschutzgesetze bieten hier eine Alternative, die für Geschädigte effektiver sein kann. Darüber hinaus wirft die Nike-Klage wichtige Fragen für den gesamten Markt der digitalen Sammlerobjekte auf. Wie sind NFTs rechtlich einzuordnen? Welche Pflichten bestehen für Unternehmen bei der Vermarktung solcher Produkte? Und wie können Verbraucher ihre Interessen schützen, wenn technologische Innovationen schneller wachsen als die Gesetzgebung? Experten warnen davor, dass ohne klare Regeln und Standards das Vertrauen der Konsumenten in Kryptowährungsprodukte langfristig Schaden nehmen könnte.
Gerade Marken mit hoher Reputation sollten sorgsam abwägen, wie und mit welchen Partnern sie in den Krypto-Bereich vorstoßen, um zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ein weiterer Aspekt, der in der Debatte rund um Nike sichtbar wird, ist die Rolle von Tochtergesellschaften und Markenimaging. RTFKT wurde als eigenständige NFT-Tochter präsentiert, doch der enge Zusammenhang mit dem Mutterkonzern Nike lässt die beiden Unternehmen rechtlich eng verflochten erscheinen. Damit steigt das Risiko, dass Nike direkt haftbar gemacht werden kann für Fehlschläge oder fragwürdige Geschäftspraktiken der Tochter. Diese Diskussion steht auch exemplarisch für die Abgrenzung von Verantwortlichkeiten in der digitalen Ökonomie.
Die Klageverfahren in New York ziehen zurzeit Aufmerksamkeit bei Investoren, Rechtsexperten und Markenstrategen auf sich. Sie verkörpern den Wandel in der Rechtslandschaft, der notwendig ist, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Zum einen zeigen sie, wie Lücken im regulatorischen Rahmen gnadenlos von Unternehmen und Verbrauchern ausgenutzt werden können. Zum anderen bieten sie aber auch Chancen, den Umgang mit Kryptowährungen, Token und digitalen Assets zu professionalisieren und nachhaltiger zu gestalten. Abseits der juristischen Perspektive offenbart der Nike-Fall auch eine grundsätzliche Unsicherheit vieler Konsumenten bei der Investition in NFTs.
Während digitale Kunstwerke und virtuelle Sammlerstücke faszinierend sind, fehlt oft das nötige Wissen über Risiken und die tatsächlichen Werte. Dadurch entstehen Spannungen zwischen Hype und Realität, die von Gerichten letztlich geklärt werden müssen. Im Fazit zeigt der Rechtsstreit gegen Nike exemplarisch die Herausforderungen des Krypto-Markts, die Bedeutung von Transparenz und Aufklärung sowie die dringende Notwendigkeit klarer Regeln. Unternehmen, die in NFTs investieren oder diese ihren Kunden anbieten, sollten in der jetzigen Phase besonders vorsichtig agieren und ihre rechtlichen Rahmenbedingungen genau prüfen. Für Verbraucher gilt, dass bei Investitionen in digitale Assets ein kritischer Blick und fundiertes Wissen unverzichtbar sind.
Die Krypto-Revolution ist unaufhaltsam, doch die Zukunft wird nur durch faire und überprüfbare Standards erfolgreich gestaltet werden können.





![[this is] The FBI, open up. China's Volt Typhoon is on your network](/images/C2F04724-7898-44D9-9380-812065AD794A)