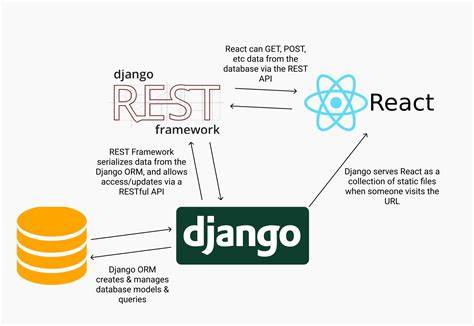Ostgalizien, eine Region im heutigen westlichen Teil der Ukraine, verfügt über eine lange Geschichte ethnischer Vielfalt und komplexer sozialer Verflechtungen. Dieses Gebiet, das vor dem Zweiten Weltkrieg überwiegend von Ukrainern bewohnt wurde, hatte bedeutende polnische und jüdische Minderheiten. Die tragischen Ereignisse des Krieges hinterließen jedoch eine Spur der Verwüstung, geprägt von sowjetischer Repression, Holocaust, ethnischen Säuberungen und politischen Konflikten, die das Leben der Bevölkerung dauerhaft beeinträchtigten. Die multidimensionale Traumatisierung der sogenannten „verflochtenen Zuschauer“ dieser Massengewalt ist ein Thema, das tiefes Verständnis fordert und neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von individuellen und kollektiven Traumata ermöglicht. Die Vorstellung von Zeugen oder Zuschauern bei Massengewalt ist häufig von der Idee geprägt, sie seien passiv oder distanziert.
Doch die Geschichte Ostgaliziens widerlegt diese Simplifizierung. Die Menschen vor Ort waren gezwungen, in unmittelbarer Nähe zu endlosem Leid und Sterben zu leben, oft unfreiwillig Teil des Geschehens zu werden, und sahen sich ständig in der Gefahr, selbst Opfer oder Täter zu werden. Diese Dynamik führte zu einem Zustand der „Verflochtenheit“ – eine Situation, in der die Grenzen zwischen den Rollen verschwimmen, wodurch die psychischen Belastungen umso schwerwiegender ausfielen. Schon zu Kriegsbeginn änderte sich das Leben in Ostgalizien grundlegend. Die sowjetische Besatzung ab 1939 brachte massive Verhaftungen, Zwangsumsiedlungen und Hinrichtungen mit sich.
Zehntausende polnische Bürger wurden deportiert oder ermordet, was bereits die soziale Struktur der Gemeinden nachhaltig zerrüttete. Die Menschen lebten in Angst vor willkürlicher Gewalt: Eltern mussten ihren Kindern die Grausamkeiten erklären oder versuchten sie vor der Sicht des Todes zu schützen, was ihnen jedoch oft nicht gelang. Die Ankunft der deutschen Wehrmacht und der Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft entfalteten eine neue Dimension der Gewalt – die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Rund 95 Prozent der jüdischen Gemeinschaft Ostgaliziens wurden ermordet. Diese Tötungen fanden nicht nur in deutschen Vernichtungslagern statt, sondern oft direkt vor den Augen der Nachbarn.
Dieser Holocaust durch Kugeln, begleitet von Pogromen, an denen auch lokale Bewohner unterschiedlicher Ethnien beteiligt waren, hinterließ tiefe seelische Wunden bei denjenigen, die das Sterben miterlebten oder indirekt davon betroffen waren. Parallel zum Holocaust fand in Ostgalizien eine ethnische Säuberung der polnischen Bevölkerung statt, die von ukrainischen nationalistischen Gruppen organisiert wurde. Inmitten dieses blutigen Konflikts kam es zu Vergeltungsakten und gegenseitigen Morden, die weiteren sozialen Zersetzungsprozessen Vorschub leisteten. Die Gewalt war allgegenwärtig, die Unterscheidung zwischen Opfer und Täter nicht immer eindeutig, was zur Verflechtung von Gruppen und Individuen in wechselnde Rollen führte. Diese Verwobenheit der Täter, Opfer und Zuschauer ist eine zentrale Facette beim Verständnis der traumatischen Erfahrungen vor Ort.
Es handelt sich um „entangled bystanders“, deren Schicksale von nahtlosen Übergängen zwischen verschiedenen Positionen geprägt waren. Viele mussten aktiv an Gruben ausheben, Leichen beseitigen oder die Verfolgung organisieren, während andere die Grausamkeiten nur passiv beobachteten oder vom Leid unmittelbar betroffen waren. Ihre traumatischen Erfahrungen gingen über bloße Beobachtungen hinaus und reichten bis hin zu Schuldgefühlen, Angst und tiefem Schmerz. Die psychologischen Folgen dieser traumatischen Erlebnisse lassen sich auf individueller Ebene in Form von posttraumatischen Belastungsstörungen, Angst- und Depressionszuständen und psychosomatischen Beschwerden festmachen. Zeitgenössische Studien aus Polen belegen, dass ein hoher Prozentsatz junger Menschen nach dem Krieg über solche Symptome klagte, selbst wenn sie nicht direkt vom Tod eines Angehörigen betroffen waren, sondern lediglich Zeugen der Gewalt wurden.
Der ständige Umgang mit Tod und Zerstörung führte zu einer dauerhaften mentalen Erschütterung bei vielen Bewohnern Ostgaliziens. Doch neben den individuellen Traumata ist der kollektive und gesellschaftliche Schaden nicht zu unterschätzen. Der Verlust ganzer Bevölkerungsgruppen führte zum Zusammenbruch vertrauter sozialer Netzwerke, zu Vertrauensverlust, sozialer Isolation und dem Zerfall traditioneller Gemeinschaften. Die wirtschaftlichen Rollen, die einzelne ethnische Gruppen innehatten, blieben oft unbesetzt – so fehlten Ärzte, Lehrer oder Handwerker. Ganze Städte und Dörfer verödeten, viele verloren ihre ehemals vielfältige, bunte Struktur, und es entstand eine Atmosphäre der Verunsicherung und des Misstrauens, die den sozialen Zusammenhalt nachhaltig schwächte.
Dieser gesellschaftliche Zusammenbruch kann als kollektives oder gemeinschaftliches Trauma bezeichnet werden – ein Trauma, das nicht nur einzelne Individuen betrifft, sondern die sozialen Grundlagen einer ganzen Region trifft. Die Normen des Zusammenlebens, die moralischen Bindungen und das Vertrauen unter Nachbarn wurden durch das massenhafte Sterben, die Gewalt und die Beteiligung der eigenen Gruppe an Verbrechen schwer erschüttert. Die Menschen verloren die Orientierung in einer Welt, die zunehmend chaotisch und bedrohlich erschien. Ergänzend zu den psychischen und sozialen Traumata mussten die Menschen in Ostgalizien mit der physischen Präsenz des Todes leben. Massengräber, Häuser und Plätze, in denen Morde stattfanden, wurden zu alltäglichen Bezugspunkten.
Oft wurden nach Kriegsende keine Grabsteine gesetzt, viele Orte zur Verschleierung der Verbrechen überbaut oder zerstört. Das Leben auf den „Knochen der Toten“ wurde zur bitteren Realität. Gleichzeitig war über viele Jahrzehnte ein Schweigen über die Vergangenheit vorherrschend – aus Angst, Scham oder politischem Druck. Dieses Verschweigen verhinderte die notwendige kollektive Aufarbeitung und trug zur Verlängerung der inneren Verletzungen bei. Die fortwährende Stille über die furchtbaren Ereignisse führte dazu, dass die traumatischen Erfahrungen über Generationen hinweg weitergegeben, aber selten offen thematisiert wurden.
Die Gemeinschaften mussten in einem Spannungsfeld zwischen Erinnerung und Vergessen, zwischen Angst und Überlebenswille existieren. Dieses komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Traumata kennzeichnet die multidimensionale Tragödie der „verflochtenen Zuschauer“ in Ostgalizien – eine Tragödie, die weit über die individuellen Erlebnisse hinausgeht. Der Begriff der „verflochtenen Zuschauer“ verweist darauf, dass ethnische Säuberungen und Massengewalt nicht nur durch Täter oder Opfer geprägt sind, sondern dass die große Mehrheit der Bevölkerung sich innerhalb eines Netzes wechselnder Rollen und Verantwortlichkeiten bewegte. Diese Positionen waren oft nicht frei wählbar, die Bewohner wurden durch ihre Herkunft, ihren sozialen Status oder äußere Zwänge in diese Rollen hineingedrängt. Die Unterscheidung von Aktivität und Passivität, von Handelnden und Beobachtern ist daher nicht einfach zu ziehen.
Diese Erkenntnisse haben Bedeutung über den Fall Ostgaliziens hinaus. Sie werfen ein Licht auf die Dynamiken von Gewalt und Trauma in multiethnischen Gesellschaften während Konflikten und Totalitarismen weltweit. Sie zeigen, dass kollektive Traumen nicht nur aus den unmittelbaren Gewalttaten resultieren, sondern aus einem komplexen Geflecht sozialer Verflechtungen, historischer Erfahrungen und der Schwierigkeit, traumatische Erinnerungen in gesellschaftliche Narrative zu integrieren. Erst in den letzten Jahrzehnten ermöglicht die Forschung eine differenzierte Annäherung an die Traumata von Angehörigen verschiedenster Gruppen in Ostgalizien unter Einbeziehung persönlicher Erfahrungsberichte, Tagebücher, Erinnerungen und oral history Interviews. Diese Quellen eröffnen einen Einblick in die Gefühlswelten und sozialen Umstände der „verflochtenen Zuschauer“, die zugleich Opfer, Zeugen und teilweise ungewollte Mitwirkende waren.
Die Erzählungen spiegeln das psychische Leiden, die Angst, die Verzweiflung, aber auch die Überlebensstrategien und das Bedürfnis nach Erinnerung wider. Die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der Geschichte ist wichtig für die historische Aufarbeitung, für die Versöhnung der Nachbarn im heutigen Ostgalizien und angrenzenden Regionen, aber auch für die präventive Arbeit gegen Wiederholung von Gewalt. Ein Verstehen der komplexen Traumatisierungen sensibilisiert für die Herausforderungen von post-konfliktiven Gesellschaften und betont die Notwendigkeit, sowohl individuelle als auch kollektive Traumata sichtbar zu machen und einen Raum für Traumaheilung und Erinnerungskultur zu schaffen. Die multidimensionale Natur der Traumata in Ostgalizien, die sich in psychischer Belastung, sozialem Zerfall und einer belasteten Erinnerungskultur manifestiert, ist trotz der historischen Herkunft hochaktuell. Sie lehrt uns, dass die Wahrnehmung von Opfern und Tätern in Konflikten vielschichtig sein muss und dass die Rolle der Zuschauer und Mittäter eine entscheidende Wirkung auf das soziale Gefüge und die Generationen danach hat.
Nur durch eine solche komplexe Sichtweise können wir das volle Ausmaß von Leid und Trauma erfassen und gegebenenfalls den Grundstein für Heilung und Versöhnung legen.