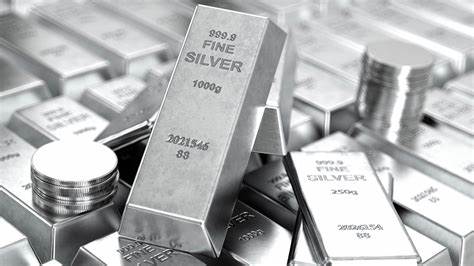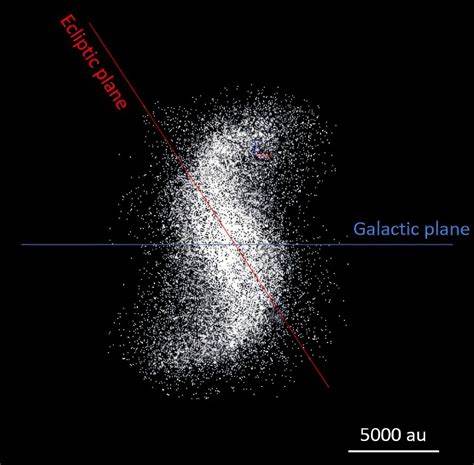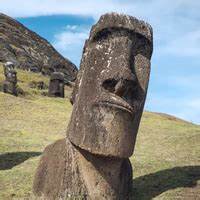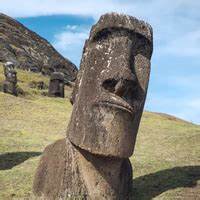In den letzten Jahren hat sich die Welt der Technologie rasant verändert, insbesondere durch die verstärkte Nutzung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). Große Tech-Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta prägen mit ihren Innovationen das digitale Zeitalter. Doch trotz der vielen Vorteile, die KI und verwandte Technologien bringen, zeigt ein Bericht der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der UN-Agentur für digitale Technologien, dass mit dem Wachstum der KI auch die indirekten CO2-Emissionen dieser Unternehmen stark angestiegen sind. So stiegen die indirekten Emissionen zwischen 2020 und 2023 durchschnittlich um 150 Prozent – eine alarmierende Entwicklung für die globale Nachhaltigkeitsagenda. Indirekte Emissionen, auch als Scope-2-Emissionen bezeichnet, umfassen dabei den CO2-Ausstoß, der nicht direkt bei den eigenen Tätigkeiten eines Unternehmens entsteht, sondern durch den Verbrauch von extern eingekaufter Energie wie Strom, Dampf, Heizung und Kühlung verursacht wird.
Für Technologieunternehmen sind vor allem Rechenzentren und die damit verbundenen infrastrukturellen Anforderungen treibende Faktoren. Datenzentren benötigen riesige Mengen an Elektrizität, um Server zu betreiben, Daten zu verarbeiten und insbesondere die rechnerischen Anforderungen von KI-Systemen zu bewältigen.Tech-Giganten investieren massiv in den Ausbau ihrer Cloud-Infrastrukturen und KI-Fähigkeiten. Amazon, bekannt für seine Cloud-Plattform AWS, verzeichnete den stärksten Anstieg bei den Emissionen mit 182 Prozent im Vergleich zu 2020. Microsoft folgte mit 155 Prozent, Meta (Facebook und WhatsApp) mit 145 Prozent und Alphabet (Google) mit 138 Prozent.
Diese immens gestiegenen Werte spiegeln sowohl den wachsenden Energiebedarf als auch die steigende Kapazität und Komplexität der KI-Systeme wider, die mittlerweile integraler Bestandteil zahlreicher digitaler Dienstleistungen und Produkte sind.Die Hintergründe für dieses exponentielle Wachstum liegen in der enormen Rechenleistung, die KI-Algorithmen benötigen. Maschinenlernen, Deep Learning und große neuronale Netzwerke werden durch immer größere Datenmengen und komplexere Modelle angetrieben und benötigen kraftvolle Hardware. Das führt zu einem drastischen Anstieg des Stromverbrauchs in Rechenzentren, die für die Datenverarbeitung und das Training dieser Modelle verantwortlich sind. Die Energie, die für Kühlung und Betrieb der Server nötig ist, trägt ebenfalls zu den indirekten Emissionen bei.
Der Bericht der ITU betont darüber hinaus, dass der Stromverbrauch von Datenzentren viermal schneller steigt als der gesamte globale Stromverbrauch. Dies zeigt die disproportionale Belastung, die von diesem Sektor ausgeht, wenn es keine entsprechenden Gegenmaßnahmen gibt. Trotz der Tatsache, dass viele Unternehmen inzwischen eigene ehrgeizige Ziele zur Reduktion der Emissionen formulieren, fallen die realen Auswirkungen oft hinter den Erwartungen zurück. Die Digitalwirtschaft steht also vor der großen Herausforderung, nachhaltiger zu werden und gleichzeitig den Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur für KI zu decken.Die betroffenen Unternehmen reagieren bereits mit verschiedenen Strategien, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Amazon investiert vermehrt in kohlenstofffreie Energiequellen, darunter erneuerbare Energien und sogar Kernenergieprojekte, um seine wachsenden Rechenzentren zu betreiben. Microsoft verfolgt innovative Ansätze zur Verbesserung der Energieeffizienz, etwa durch die Entwicklung fortschrittlicher Kühlungstechnologien auf Chipebene, die klassische Kühlsysteme ersetzen sollen, und berichtet von einer Verdoppelung der Einsparung bei Energieverbrauch im letzten Jahr. Meta fokussiert sich auf die Reduktion von Emissionen, Energie- und Wasserverbrauch seiner Infrastruktur und veröffentlicht regelmäßige Nachhaltigkeitsberichte, um seine Fortschritte transparent darzustellen.Nichtsdestotrotz zeigt der Bericht der ITU, dass der bestehende Infrastrukturbedarf und der steigende Energiehunger von KI-Anwendungen das globale Energieversorgungssystem stark beanspruchen können. Alte Energiesysteme und Netze sind möglicherweise nicht für den exponentiellen Energiebedarf der Zukunft ausgelegt, was Investitionen in nachhaltige, klimaschonende und leistungsfähige Energieinfrastrukturen erfordert.
Der Ausbau von erneuerbaren Energien und der Umstieg auf saubere Technologien werden dabei zentrale Rollen spielen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle der politischen Rahmenbedingungen und regulatorischen Maßnahmen. Ohne verbindliche Vorgaben zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz könnten selbst ambitionierte Unternehmensziele unzureichend sein. Internationale Zusammenarbeit, klar definierte Klimaziele und eine konsequente Überwachung der tatsächlichen Emissionen sind essenziell, um den Trend zu brechen. Förderung von Innovationen im Bereich grüner Technologien sowie Anreize für nachhaltigen Unternehmensausbau können hier unterstützend wirken.
Neben der Umweltperspektive darf auch die wirtschaftliche Dimension nicht außer Acht gelassen werden. Die steigenden Energiekosten und die volatile Energieversorgung können Unternehmen vor Herausforderungen stellen und die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Investitionen in Energieeffizienz und nachhaltige Technologien können langfristig Kosten senken und gleichzeitig das Unternehmensimage stärken – ein Aspekt, der im Kontext zunehmender Konsumenten- und Investorenorientierung auf Nachhaltigkeit immer wichtiger wird.Die Rolle der Verbraucher und gesellschaftlichen Akteure ist ebenso bedeutend. Mehr Transparenz über den Energieverbrauch digitaler Dienste, bewussterer Umgang mit Technologien und Unterstützung für nachhaltige IT-Produkte könnten den Druck auf Unternehmen erhöhen, ihre Umwelteinflüsse zu reduzieren.