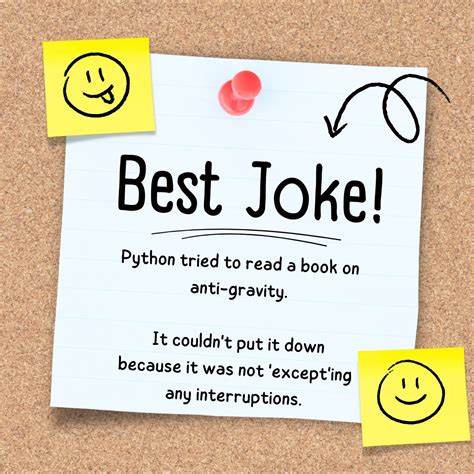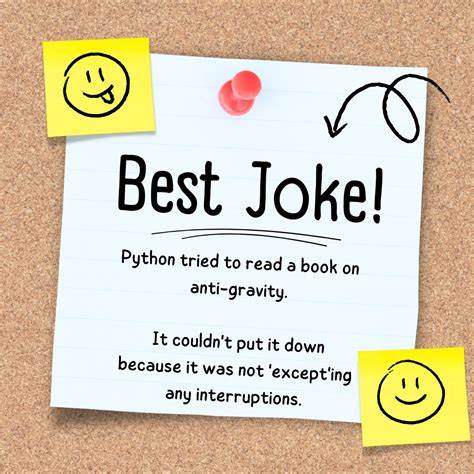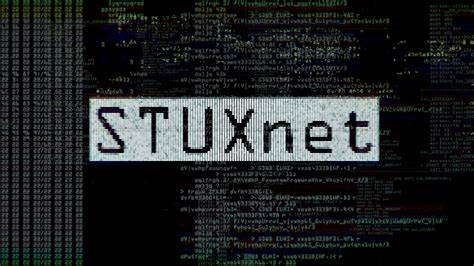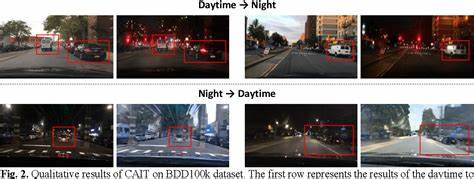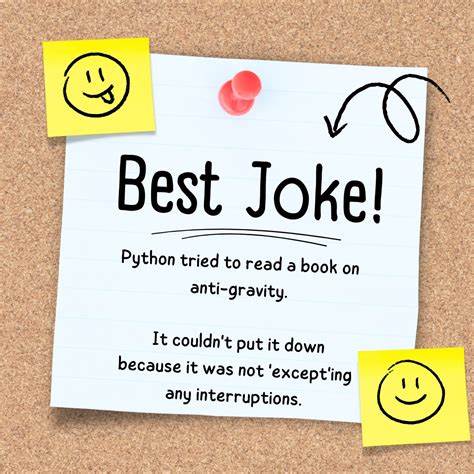In der Welt der Softwareentwicklung gibt es zahlreiche Beispiele für guten und schlechten Code. Während guter Code sauber, verständlich und wartbar ist, handelt es sich beim schlechten Code oft um das exakte Gegenteil. Dennoch kann es sehr lehrreich und unterhaltsam sein, sich vor Augen zu führen, wie man den schlechtesten Python-Code schreibt – natürlich mit einem Augenzwinkern. Genau dies wollen wir in diesem humorvollen Leitfaden erkunden und dabei typische Fehler, Missverständnisse und absurde Praktiken beleuchten, die man besser vermeiden sollte, um nicht zum Schrecken jedes Entwicklerteams zu werden. Beginnen wir mit dem Thema der Variablennamen.
Klarheit ist hier das A und O. Doch wenn man den schlechtesten Code schreiben möchte, darf es keine selbsterklärenden Namen geben. Variablen sollten so kryptisch und bedeutungslos wie möglich sein. Ein zweckentfremdeter Name wie "f" für eine Funktion oder „a“, „b“, „c“ für Variablen, die komplexe Berechnungen durchführen, sorgen für maximale Verwirrung. Besonders effektvoll wird es, wenn Variablennamen mehrfach mit unterschiedlichen Datentypen oder Werten belegt werden.
Auf diese Weise fühlt sich jeder, der den Code liest, wie beim Versuch, ein Rätsel ohne Lösungsbuch zu knacken. Ein weiterer beliebter Weg, schlechten Python-Code zu schreiben, besteht darin, keine Kommentare oder Dokumentationen zu verwenden. Warum sollte man den Zweck einer Funktion oder die Bedeutung komplexer Algorithmen erklären, wenn man stattdessen das gesamte mysteriöse Geheimnis bewahren kann? Das Fehlen von Kommentaren führt dazu, dass der Code für niemanden nachvollziehbar ist – ein Traum für jeden Entwickler, der am liebsten jeden Tag von vorne anfangen möchte, wenn es um die Wartung geht. Ein wichtiges Thema in schlechtem Python-Code ist auch die Ignoranz gegenüber Python-eigenen Funktionen und Best Practices. Die Sprache bietet viele elegante und effiziente Mittel, um Aufgaben zu bewältigen, wie List Comprehensions, Generatoren oder aussagekräftige Fehlermeldungen.
Wer den schlechtesten Code schreiben will, vermeidet diese wunderbaren Werkzeuge konsequent und implementiert stattdessen umständliche, ineffiziente Schleifen und fehleranfällige Konstruktionen. So wird der Code nicht nur langsamer, sondern auch schwieriger zu verstehen und zu warten. Was die Struktur eines schlechten Python-Programms betrifft, sind unübersichtliche, verschachtelte und lange Funktionen ein Muss. Funktionen, die mehrere Verantwortlichkeiten übernehmen und hunderte Zeilen Code enthalten, erschweren das Debuggen und die Fehleranalyse ungemein. Zusätzlich macht man sich keine Gedanken über Modularität oder Wiederverwendbarkeit.
Stattdessen schreibt man stumpf Codezeilen aneinander und dupliziert Logik, so dass Änderungen an einer Stelle zwangsläufig zu Fehlern an anderen führen. Der Umgang mit Fehlern ist eine weitere Quelle für katastrophalen Code. Anstatt Ausnahmen präzise abzufangen und aussagekräftige Fehlermeldungen zu erzeugen, ignoriert schlechter Code Fehlermeldungen entweder komplett oder drückt sie mit einer allgemeinen Ausnahmebehandlung weg. Besonders beliebt ist es, Exceptions einfach mit „pass“ zu überspringen oder sie wortlos zu unterdrücken – was später für nächtelange Fehlersuche in produktiven Systemen sorgt. Auch die Wahl der Datenstrukturen kann zum Hindernis werden.
Für schlechte Programmierung kann man zum Beispiel Listen dort verwenden, wo Dictionaries oder Sets viel effizienter und aussagekräftiger wären. Noch besser ist es, redundante Datenstrukturen zu verwenden oder globale Variablen hemmungslos zu mischen. Globale Variablen wirken wie eine geheime Hintertür, die jeder Teil des Programms einfach aufbrechen kann. Sie fördern unerwartete Nebeneffekte und machen die Fehlersuche zur Wahnsinnsaufgabe. Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist die Formatierung und Einrückung des Codes.
Python lebt von seiner klaren Syntax und Einrückung, doch schlechter Code wird oft wahllos eingerückt oder nutzt inkonsistente Einrückungsstufen. Das Resultat sind Syntaxfehler oder unverständliche Programmstrukturen. Übrigens ist es im schlimmsten Fall durchaus möglich, Einrückungen so zu setzen, dass der Code zwar syntaktisch korrekt ist, aber logisch verrückte Abläufe entstehen. Die sogenannte „DRY“-Regel (Don't Repeat Yourself) gehört nicht in das Repertoire schlechter Entwickler. Duplikate von Codeabschnitten sind besonders beliebt, um Wartungsaufwand unnötig zu erhöhen.
Durch diese Praxis ist es besonders wahrscheinlich, dass Fehler in einer Kopie korrigiert und in anderen vergessen werden, was zu unerwarteten Fehlerketten führt. Darüber hinaus empfiehlt sich bewusstes Ignorieren von Entwicklertools und statischen Codeanalysewerkzeugen. Diese Tools sind dazu da, um Codequalität zu verbessern und Fehler frühzeitig zu erkennen. Wer wirklich den schlechtesten Code schreiben möchte, lässt diese Hinweise gerne unbeachtet und umgeht beispielsweise Linter-Empfehlungen oder Testabdeckungen. So sammelt sich technischer Schuldenberg an, der irgendwann zu einem massiven Problem wird.
Auch das Missachten von PEP8, dem Style-Guide für Python, ist ein klassischer Fehler. Einheitliche Formatierung steigert Lesbarkeit und Teamarbeit. Verzichtet man darauf, erzeugt man Code, der so aussieht, als wäre er von mehreren Personen mit komplett verschiedenen Stilrichtungen geschrieben. So entsteht ein Flickenteppich, der niemandem hilft. Ein spannendes Element zur Erzeugung von schlechtem Code ist die Verwendung von magischen Zahlen und Strings ohne Erklärung.
Statt Konstanten zu definieren und zu benennen, werden Zahlen und Textschnipsel wild in den Code eingebaut. Dies erschwert nicht nur das Verständnis, sondern bringt auch Fehlerquellen mit sich, wenn Werte an mehreren Stellen geändert werden müssen. Schlechte Python-Programme setzen oftmals auf unnötige Komplexität. Einfachste Aufgaben werden mit verschachtelten Logikverzweigungen, unnötigen Klassenhierarchien oder überflüssigen Entwurfsmustern umgesetzt. Dadurch wird nicht nur die Lesbarkeit eingeschränkt, sondern auch die Performance leidet unnötig.
Ein weiterer Fauxpas ist mangelnde Fehlerbehandlung bei Benutzereingaben oder externen Schnittstellen. Programme, die blind jeden Input akzeptieren und keine Validierung einbauen, laufen Gefahr, unerwartet zu brechen oder Sicherheitsrisiken zu erzeugen. Wer wirklich schlechten Code schreiben will, ignoriert diese wichtige Praxis vollständig. Nicht zu vergessen ist die fehlende Modularisierung und das Auslassen von Funktionen bei wiederkehrenden Aufgaben. Stattdessen schreibt man immer wieder den gleichen Code neu, anstatt ihn in eine Funktion auszulagern.
Besonders fatal, wenn sich Fehler in diesen mehrfach verwendeten Abschnitten einschleichen und überall auftauchen. Schlechter Python-Code zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass er keinerlei Tests enthält. Tests helfen dabei, Bugs frühzeitig zu erkennen und das Verhalten von Funktionen zu dokumentieren. Wer keine Tests schreibt, legt den Grundstein für Probleme im späteren Entwicklungsverlauf und verursacht zusätzlichen Aufwand für sein Team. Während guter Python-Code wahrscheinlich sinnvolle Ausnahmebehandlungen enthält, die präzise und verständlich sind, erkennen schlechte Programme nicht, wann sie überhaupt Ausnahmen behandeln sollten.
Diese fehlende Sensibilität erzeugt frustrierende Fehlersituationen, die nur schwer zu diagnose sind. Selbstverständlich darf ein Hauch von schlechter Formatierung auch bei der Nutzung von Einrückungen, Leerzeichen und Zeilenlängen nicht fehlen. Chaos in der Formatierung macht es schwer, Codeabschnitte auf den ersten Blick zu erfassen und Fehler schnell zu identifizieren. Neben all diesen technischen Aspekten spielt auch die Zusammenarbeit im Team eine Rolle. Schlechter Code berücksichtigt keine Konventionen, keine Reviews und keinerlei Feedback-Prozesse.
Änderungen werden ohne Rücksprache eingespielt und niemand dokumentiert seine Arbeit. Dies führt zu einem Zerfall der Codebasis, dem sogenannten „Software Rot“. Zuletzt sollte man sich auch fragen, wie Variablen und Funktionen ihre Werte und Aufgaben erhalten. Dynamische Typisierung von Python wird dazu missbraucht, wild durch den Code durchgereicht zu werden, ohne dass klar ist, welcher Datentyp zu erwarten ist. Somit vermeidet man jegliche Typprüfung und sorgt unweigerlich für Probleme zur Laufzeit.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der schlechteste Python-Code das genaue Gegenteil von dem ist, was man von einem echten Profi erwartet. Er ignoriert Klarheit, Struktur, Testbarkeit und Zusammenarbeit. Er ist ein Puzzle für jeden Entwickler, der anschließend stundenlang versucht, zu verstehen, was eigentlich programmiert wurde. Doch gerade durch die humorvolle Auseinandersetzung mit diesen Fehlern kann man viel lernen – und so den eigenen Programmierstil verbessern. Wer also einmal den Spieß umdrehen will, dem sei empfohlen, die hier aufgeführten „Tipps“ zum schlechten Python-Code zu befolgen – allerdings nur aus Spaß.
Im echten Projektalltag sollten diese Praktiken unbedingt vermieden werden, um eine gesunde, produktive und professionelle Entwicklung sicherzustellen.