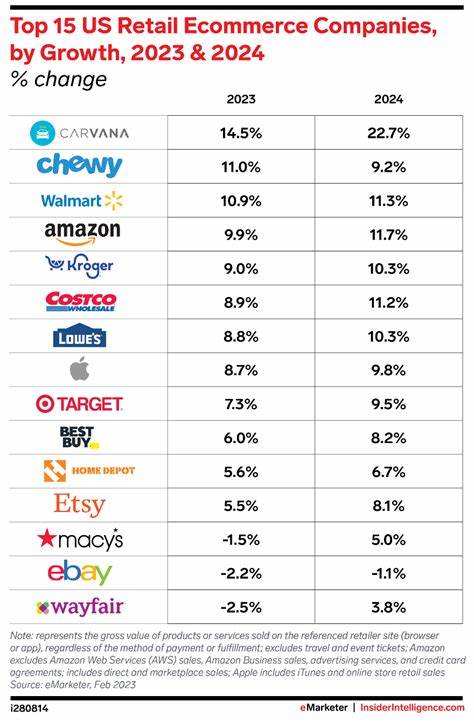Python gilt als eine der klarsten und einsteigerfreundlichsten Programmiersprachen der Welt. Doch so elegant und mächtig sie ist, kann sie auch auf spektakulär schlechte Weise eingesetzt werden. Programmierer, die das Chaos lieben, werden sich von den besten (oder sagen wir „schlechtesten“) Praktiken inspirieren lassen, wie man Python-Code so verunstaltet, dass Entwicklerkollegen im Büro fluchen – und das alles mit einer gehörigen Portion Humor. Tauchen wir gemeinsam ein in die skurrile Welt des schlechtesten Python-Codes und warum es besser ist, diese Fehler zu vermeiden. Ein zentrales Element, das jede Katastrophe perfektioniert, ist die Wahl der Variablennamen.
Statt klarer und aussagekräftiger Namen herrscht die Kunst der kryptischen Abkürzungen: f, x, y, data1, thing, temp – je undurchsichtiger, desto besser. So wird nicht nur das Debuggen zum Ratespiel, sondern auch das spätere Verstehen des Codes zu einer nervenaufreibenden Detektivarbeit um zwei Uhr morgens. Das ultimative Meisterwerk erreichen Programmierer, wenn dieselben Variablennamen innerhalb ein und derselben Funktion für völlig unterschiedliche Werte genutzt werden. Ein Vergnügen für die Nachwelt! Weiter geht es mit Imports: Wer möchte sich schon die Mühe machen, nur die wirklich benötigten Bibliotheken zu importieren? Stattdessen kommt die Universallösung zum Einsatz: Wildes Importieren aller möglichen Module an beliebigen Stellen im Code, verteilt wie Konfetti. Dies sorgt für eine schöneren Chaos-Effekt mit unterschiedlichen Versionen einer Funktion, Namenskonflikten und Stunden verschwendet bei der Fehlersuche.
Übersichtlichkeit? Fehlanzeige. Kodierende Autoren, die nach noch mehr Herausforderung im Leben suchen, ignorieren das Prinzip der Einzelverantwortlichkeit komplett. Am besten packt man so viele Aufgaben wie möglich in eine einzige Funktion – von Validierung über Datenbereinigung, Mailversand, Datenbankaktualisierung bis hin zur Berichterstellung. Die Funktion wächst auf hunderte Zeilen an und bietet dem Programmierer die Chance, das gesamte Projekt quasi auf Knopfdruck in den Wahnsinn zu treiben. Wartbarkeit? Schlichtweg unmöglich.
Auch der Umgang mit Fehlern verdient eine Auszeichnung für besondere Grausamkeit. Fehler werden abgefangen, aber niemals sinnvoll behandelt. Das „try except pass“-Konstrukt ist die beliebteste Methode, um Probleme elegant zu ignorieren und einfach weiterzumachen, während sich der Code stillschweigend in einen riesigen Bug-Nest verwandelt. Noch besser wird es, wenn Fehler als Erfolg gemeldet werden – denn im besten Fall wollen wir doch so wenig Aufwand wie möglich mit Problembehebung haben. Kommentare? Ach woher! Warum sollte man die eigene Genialität mit Erklärungen erhellen, wenn Dritte sich selbst mit komplizierten und unverständlichen Einzeilern oder ineinander verschachtelten List Comprehensions auseinandersetzen können? Das sorgt für den Extra-Kick an Frustration und ein langanhaltendes Gefühl von Erfolgsdruck bei Kollegen und Nachfolgern.
Eine weitere „Best Practice“ in der Kategorie schlechtester Code ist exzessiver Gebrauch von globalen Variablen. Sie dienen als Riesensatz von Nebenwirkungen, die erwartbar unvorhersehbare Programmzustände auslösen. Globale Zustände werden hemmungslos von allen Funktionen verändert und sorgen so für unvergleichlichen Bug-Spaß. Debugging entwickelt sich so zum aufregenden Abenteuer mit Schatzsuche in unendlichen Zustandsänderungen. String-Verkettung ist offenbar ebenfalls zu aufwendig.
Klar strukturierte Formatierungs-Methoden wie f-Strings oder .format() sind für Schwächlinge. Stattdessen kommen wild verschachtelte Verkettungen mit Plus-Zeichen zum Einsatz – mit eingebautem Risiko auf SQL-Injection und andere kritische Sicherheitslücken. Je mehr potenzielle Angriffspunkte, desto besser. Was Performance angeht, ist Faulheit König.
Es werden bewusst ineffiziente Konzepte gewählt, wie das Durchsuchen von Millionen von Datensätzen mit linearen Suchalgorithmen, ohne jegliche Indexierungen oder Caching. Aus Nutzerperspektive wird so die Wartezeit gezielt maximiert – schließlich sollen Server das Training für Muskelaufbau bekommen. Konfigurationswerte werden natürlich überall verstreut und verteilt, am besten fest im Code hardcodiert und mehrfach an unterschiedlichen Stellen mit abweichenden Werten. Wer braucht schon Übersicht und zentrale Verwaltung? Kopieren und Einfügen, kurz Copy-Paste, ist das heilige Prinzip vieler Anti-Helden der Python-Welt. Anstatt eine Funktion zu schreiben und wiederzuverwenden, wird der Code lieber mehrfach mit kleinen Variationen neu erstellt.
So wird jedes Update zum fröhlichen Bug-Hopping-Abenteuer, bei dem man garantiert etwas übersieht oder subtil etwas anders programmiert – besser geht’s nicht für spannende Softwarewartung! Bibliotheken sind selbstverständlich verpönt. Wer das Rad lieber selbst neu erfindet, schreibt eigene HTTP-Clients aus ein paar Zeilen Socket-Code, CSV-Leser ohne Rücksicht auf Sonderfälle und Kryptographie-Algorithmen mit rudimentären Additionsverfahren. Dank dieser originellen Eigenkreationen lernen Entwickler hautnah und mit viel Herzblut, warum Profis eigentlich auf etablierte Werkzeuge setzen. Moderne Werkzeuge wie IDEs oder AI-Assistenten werden zudem durch hartnäckige Sturheit ersetzt. Wer vor fehlerhaften Bildern, Auto-Completion und Syntaxhervorhebung zurückschreckt, programmiert einfach mit dem altmodischen Notepad, entdeckt Tippfehler und Logikfehler erst beim Ausführen und hebt so den Nervenkitzel auf ein neues Level.
KI-basierte Code-Helfer? Nicht mit echten Meistern des Chaos. Sie schreiben alles selbst, leiden, verstehen ihre eigene kryptische Syntax kaum und finden Bugs per Click – schließlich gehört das zum Programmiererleben dazu. Tests? Ach, Tests sind nur was für Menschen mit zu viel Freizeit. Echte Profis schicken ihre Programme ungeprüft höchstselbst in die Produktion und warten auf die echte Realität, in der eine potenziell instabile Operation plötzlich Leben und Kundenkontakt gefährden kann. Am Ende ist all das natürlich als spaßige Warnung zu verstehen.
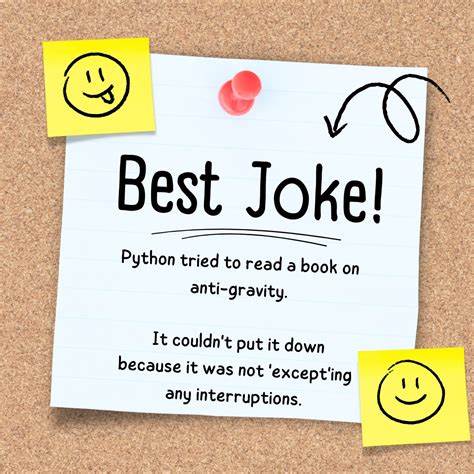


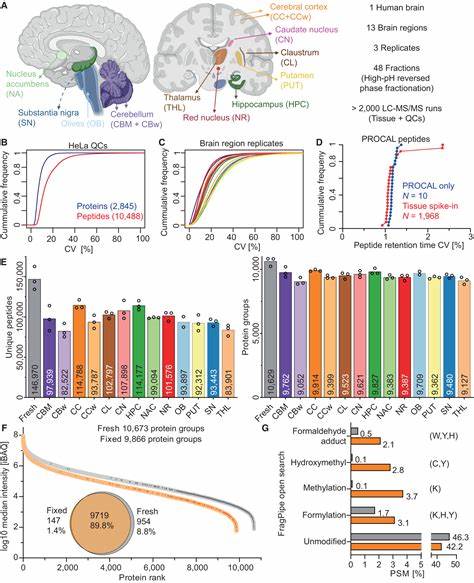


![China's booming EV industry – BBC News [video]](/images/3F4EBBBC-4ED8-4E32-9008-D2B4275EE2C1)