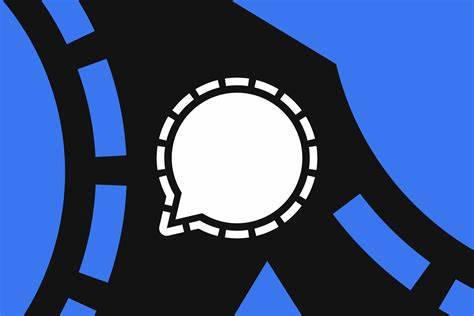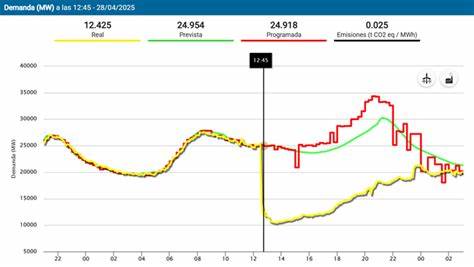Mikrochiptechnologien sind das Herzstück moderner Innovationen und unverzichtbar für zahlreiche Schlüsselindustrien wie Verteidigung, grüne Technologien und die künstliche Intelligenz. Angesichts der wachsenden Bedeutung dieser Komponenten hat sich die Europäische Union das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 rund 20 Prozent der weltweiten Mikrochipproduktion selbst abzudecken. Dieses Vorhaben ist jedoch laut einem aktuellen Bericht des Europäischen Rechnungshofs (ECA) nicht nur ambitioniert, sondern „tiefgehend von der Realität losgelöst“. Die Bedeutung von Mikrochipstrategien in einem globalisierten Markt Mikrochip-Halbleiter sind essenzielle Bausteine für die Herstellung von elektronischen Geräten und haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil unterschiedlichster Industriezweige entwickelt. Besonders in Automobilen haben Mikrochips in den vergangenen Jahrzehnten einen exponentiellen Anstieg in Anzahl und Komplexität erfahren.
Moderne Fahrzeuge beinhalten heute bereits über 1500 dieser kleinen Halbleiter, und Prognosen gehen davon aus, dass sich diese Zahl bis 2030 verdoppeln wird. Die Pandemie hat zudem die weltweiten Lieferketten belastet und verdeutlicht, wie gefährlich Engpässe bei Mikrochips für die Wirtschaft sein können. Ein gutes Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie, in der die Chipknappheit dazu führte, dass die Produktion auf das Niveau der 1970er Jahre zurückgefallen ist. Vorreiter versus Herausforderer: Europas Position im globalen Wettlauf Während die EU plant, ihre Marktanteile im Halbleiterbereich massiv auszubauen, investieren globale Hauptakteure wie TSMC aus Taiwan, Samsung aus Südkorea oder Intel aus den USA mit immensen finanziellen Mitteln in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. Zwischen 2020 und 2023 veranschlagten diese Top-Player zusammen mehr als 425 Milliarden US-Dollar an Investitionen – ein Budget, das die EU mit ihrem Ziel von 86 Milliarden Euro bis 2030 deutlich übersteigt.
Insbesondere Taiwan wird bis 2030 voraussichtlich wieder die Weltspitze bei der Chipproduktion übernehmen, und China strebt eine führende Rolle mit einem erwarteten Marktanteil von 22 Prozent an. Demgegenüber steht Europa vor der Herausforderung, den eigenen Marktanteil von aktuell knapp 8 Prozent drastisch erhöhen zu müssen, was eine Vervierfachung der Produktionskapazitäten erfordern würde. Strukturelle und finanzielle Hemmnisse innerhalb der EU Der Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs hebt hervor, dass die europäischen Finanzierungsmechanismen und Förderprogramme für die Mikrochipindustrie stark fragmentiert sind. Unterschiedliche nationale Steueranreize, konkurrierende Investitionsförderungen und der Mangel an einer koordinierenden Gesamtstrategie verhindern eine effiziente Bündelung der Ressourcen. Dieser Zustand sorgt dafür, dass die EU trotz kleiner Förderprogramme teilweise in den Rückstand gerät.
„Wir machen Versprechen, die tief von der Realität getrennt sind“, erläutert Annemie Turtelboom, die verantwortliche Prüferin des Berichts. Sie warnt davor, dass Europa technisch und finanziell im globalen Wettbewerb um Halbleiterproduktion von hinten startet und die benötigten Kompetenzen und Mittel fehlen könnten, um gegenüber anderen Technologiemächten konkurrenzfähig zu bleiben. Der verzögerte Bau von Chip-Fertigungskapazitäten in Europa verdeutlicht diese Problematik. So hat Intel die für Deutschland geplante Anlage in Magdeburg, die mit einer Investition von bis zu 30 Milliarden Euro veranschlagt wurde, wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten auf unbestimmte Zeit verschoben. Dieser Rückschlag wirkt sich direkt auf die Fähigkeit der EU aus, ihre 20-Prozent-Marktanteilsziele zu erreichen.
Chips Act: Ein erster Schritt, aber mit Einschränkungen Mit dem Chips Act, der 2022 angekündigt und 2023 in Kraft getreten ist, verfolgt die EU das Ziel, die Abhängigkeit von Drittstaaten bei der Versorgung mit kritischen Halbleiterkomponenten zu verringern. Das Gesetz soll Fördermittel mobilisieren, Investitionen anregen und die europäische Mikrochipproduktion stärken. Laut dem Rechnungshof hat der Chips Act zwar einen Impuls für die Produktion gegeben und die Mittel des Europäischen Kommission sind mit der angestrebten Strategie abgestimmt. Allerdings wurde dieser Akt unter zeitlichem Druck vorbereitet, ohne ein umfassendes Mandat, um nationale Investitionen zu koordinieren oder die verschiedenen Finanzierungsströme zusammenzuführen – was die Effektivität teilweise einschränkt. Ferner fordert der Rechnungshof eine engere Überwachung der Steueranreize, damit diese tatsächlich zu einem verstärkten Investment in den Halbleiterbereich führen.
Die derzeitigen Anreizsysteme seien zudem abhängig von wenigen großen Akteuren – fällt einer aus, wirkt sich dies gravierend auf die Zielerreichung aus. Auswirkungen eines möglichen Scheiterns und Bedeutung für Europas Zukunft Das Auseinanderklaffen zwischen ambitionierten Zielen und der aktuell realistischen Umsetzung birgt Risiken für die technologische und wirtschaftliche Souveränität Europas. Eine zu starke Abhängigkeit von außereuropäischen Zulieferern könnte Europas Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig schwächen, gerade in Schlüsselindustrien wie der Verteidigung, Automobilbranche oder bei Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz. Der globale Chipmarkt wird zu einem zentralen Schauplatz geopolitischer Spannungen und Schutzmaßnahmen. Beispielhaft dafür sind die angedrohten US-Zölle auf Chipimporte, die zu einem Zusammenbruch der Lieferketten führen könnten und Europa noch verwundbarer machen.
Die EU muss also ihre Strategie an den Bedingungen des globalen Wettbewerbs ausrichten und zugleich die Voraussetzungen schaffen, um mit anderen Technologiemächten mithalten zu können. Fazit und Ausblick Die ehrgeizigen Pläne der EU, im globalen Halbleitermarkt eine führende Rolle einzunehmen, stehen vor erheblichen praktischen und finanziellen Herausforderungen. Die Fragmentierung der Förderprogramme, das Fehlen einer abgestimmten Gesamtstrategie und die immensen Investments anderer Weltregionen setzen dem europäischen Vorhaben enge Grenzen. Die Verzögerungen beim Ausbau der Produktion und die prekäre Lage bei Lieferketten unterstreichen die Dringlichkeit für europäische Entscheidungsträger, ihre Strategie essenziell zu überdenken und innovativere Möglichkeiten der Finanzierung und Koordination zu schaffen. Darüber hinaus ist eine engere Einbindung der Industrie, eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten und eine konsequente Überwachung von Investitionsmechanismen sowie Steueranreizen gefragt.
Nur mit einem ganzheitlichen und realitätsorientierten Ansatz kann die EU ihre Chancen verbessern, im globalen Rennen um die technologische Zukunft nicht nur mitzuhalten, sondern zu den entscheidenden Akteuren zu gehören. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Europa auf diesem kritischen Sektor den Rückstand aufholen und sich gegen die dominierenden Player behaupten kann oder ob es weiterhin im Schatten konkurrierender Industrienationen verbleibt.